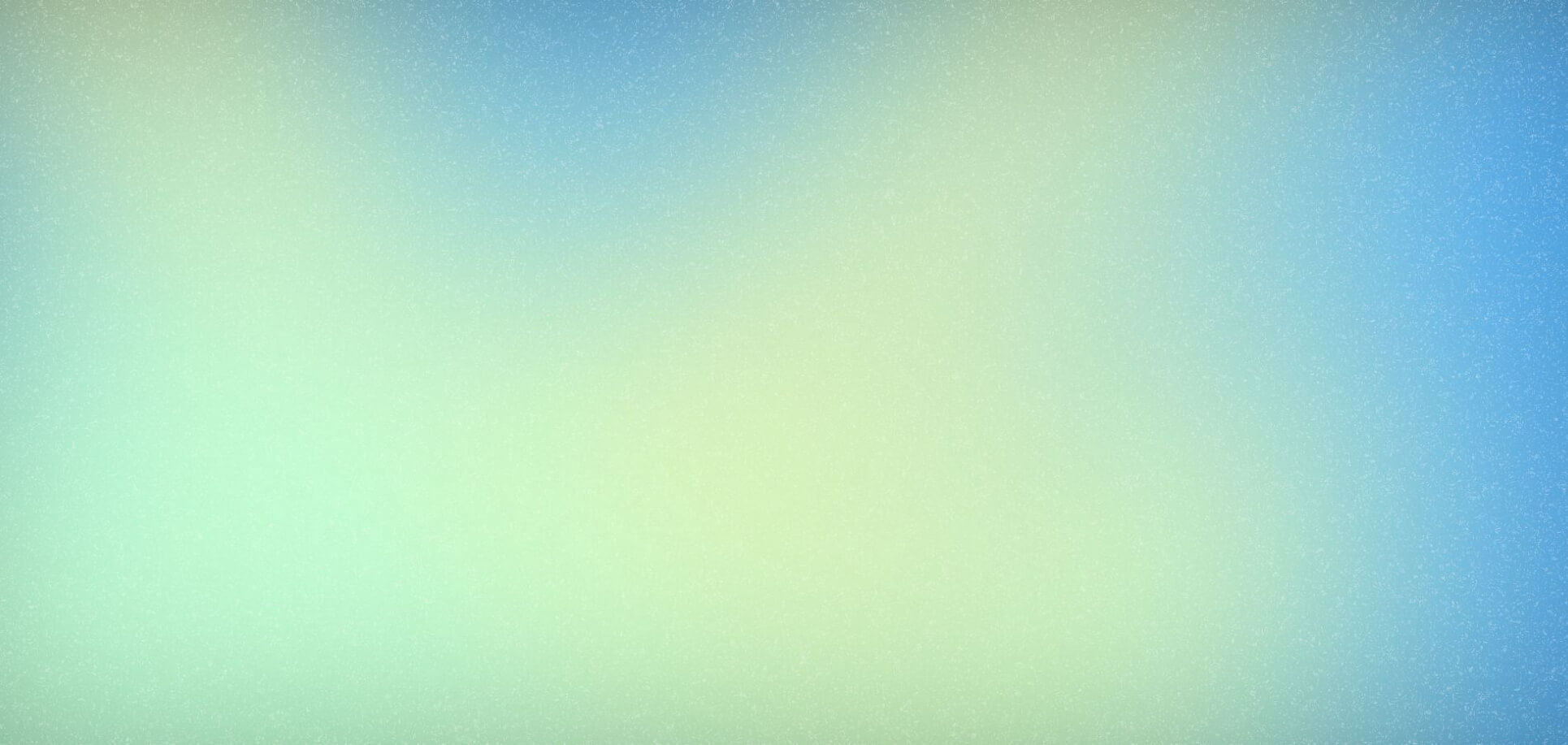Die Grundsätze zum Werkstattrisiko gelten auch für Kfz-Sachverständige
Der BGH hat seine Grundsätze zum Werkstattrisiko abermals fortentwickelt, die er in seinen Urteilen vom 16. Januar 2024 für überhöhte Kostenansätze einer Werkstatt für die Reparatur des beschädigten Fahrzeugs aufgestellt hat.
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil der 1. Zivilkammer des Landgerichts Mühlhausen vom 7. September 2022 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Tatbestand
Die Klägerin nimmt den beklagten Haftpflichtversicherer aus abgetretenem Recht auf Ersatz restlicher Sachverständigenkosten nach einem Verkehrsunfall in Anspruch. Bei diesem wurde der Pkw des Geschädigten durch einen Versicherungsnehmer der Beklagten beschädigt. Die volle Haftung der Beklagten dem Grunde nach steht außer Streit.
Der Geschädigte beauftragte im März 2021 die Klägerin, Inhaberin eines Sachverständigenbüros, mit der Begutachtung seines verunfallten Pkw und trat gleichzeitig die diesbezüglichen Schadensersatzansprüche gegenüber der Beklagten an die Klägerin ab. Die Beklagte erstattete die Kosten für das Gutachten mit Ausnahme der von der Klägerin in Rechnung gestellten Position "Zuschlag Schutzmaßnahme Corona" in Höhe von 20 €.
Die Klägerin hat diese Rechnungsposition damit begründet, dass sie insbesondere Desinfektionsmittel, Einwegreinigungstücher und Einmalhandschuhe habe anschaffen müssen. Mit der Klage hat sie die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 20 € nebst Zinsen verlangt.
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klageziel weiter.
Gründe
I.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung darauf gestützt, dass keine Kausalität zwischen der Notwendigkeit der medizinischen Schutzmaßnahmen und dem Gutachtenauftrag zu erkennen sei. Ferner sei aus dem Umstand, dass bei der Änderung des JVEG zum 21. Dezember 2020 eine Pauschale für solche Schutzmaßnahmen nicht geregelt worden sei, zu schließen, dass derartige Aufwendungen mit der Erhöhung der Stundensätze des Grundhonorars abgegolten sein sollten. Auch die BVSK-Honorarbefragung 2020 berücksichtige eine Pauschale nicht. Weiter diene die Desinfektion nicht der Schadensbeseitigung, sondern coronabedingt dem Schutz der Mitarbeiter; sie seien daher Teil der pandemiebedingten ordnungsgemäßen Arbeitsplatzgestaltung.
II.
Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die vom Berufungsgericht angestellten Erwägungen zur Ersatzfähigkeit des dem Geschädigten für die Begutachtung des beschädigten Fahrzeugs in Rechnung gestellten "Zuschlags Schutzmaßnahme Corona" (im Folgenden: Corona-Pauschale).
1. Dem Geschädigten und Zedenten stand dem Grunde nach ein Anspruch gegen die Beklagte auf Ersatz der Kosten des eingeholten Sachverständigengutachtens aus § 7 StVG, § 115 VVG zu. Denn diese Kosten gehören zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen und gemäß § 249 BGB auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist (vgl. nur Senatsurteile vom 7. Februar 2023 - VI ZR 137/22, NJW 2023, 1718 Rn. 48; vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21, NJW 2023, 1057 Rn. 8; jeweils mwN). Dieser Anspruch ist auf die Klägerin übergegangen, § 398 BGB.
2. Ist wegen der Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Geschädigte gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen (sog. "Ersetzungsbefugnis"). Im Ausgangspunkt ist sein Anspruch auf Befriedigung seines Finanzierungsbedarfs in Form des zur Wiederherstellung objektiv erforderlichen Geldbetrags gerichtet (Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 10). Der Geschädigte ist nach schadensrechtlichen Grundsätzen in der Wahl der Mittel zur Schadensbehebung frei. Er darf zur Schadensbeseitigung grundsätzlich den Weg einschlagen, der aus seiner Sicht seinen Interessen am besten zu entsprechen scheint. Denn Ziel der Schadensrestitution ist es, den Zustand wiederherzustellen, der wirtschaftlich gesehen der hypothetischen Lage ohne das Schadensereignis entspricht. Der Geschädigte ist deshalb grundsätzlich berechtigt, einen qualifizierten Gutachter seiner Wahl mit der Erstellung des Schadensgutachtens zu beauftragen (vgl. nur Senatsurteile vom 7. Februar 2023 - VI ZR 137/22, NJW 2023, 1718 Rn. 52; vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21, NJW 2023, 1057 Rn. 10; jeweils mwN).
3. Der Geschädigte kann jedoch vom Schädiger nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und notwendig erscheinen. Er ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. Allerdings ist bei der Beurteilung, welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, auch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen (sog. subjektbezogene Schadensbetrachtung). Auch ist der Geschädigte grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Markts verpflichtet, um einen möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen (vgl. nur Senatsurteile vom 7. Februar 2023 - VI ZR 137/22, NJW 2023, 1718 Rn. 53; vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21, NJW 2023, 1057 Rn. 11; jeweils mwN).
4. Ferner gilt für die Ersetzungsbefugnis des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB das Verbot, sich durch Schadensersatz zu bereichern. Der Geschädigte soll zwar volle Herstellung verlangen können (Totalreparation), aber an dem Schadensfall nicht "verdienen" (st. Rspr., vgl. nur Senatsurteile vom 29. Oktober 2019 - VI ZR 45/19, VersR 2020, 174 Rn. 11; vom 18. Oktober 2011 - VI ZR 17/11, NJW 2012, 50 Rn. 6 mwN). Die dem Geschädigten zur Verfügung zu stellenden Mittel müssen so bemessen sein, dass er, sofern er wirtschaftlich vernünftig verfährt, durch die Ausübung der Ersetzungsbefugnis weder ärmer noch reicher wird, als wenn der Schädiger den Schaden gemäß § 249 Abs. 1 BGB beseitigt (Senatsurteile vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 13; vom 26. April 2022 - VI ZR 147/21, NJW 2022, 2840 Rn. 12; vom 29. Oktober 1974 - VI ZR 42/73, BGHZ 63, 182, 184, juris Rn. 9).
5. Darüber hinaus sind die Grundsätze zum Werkstattrisiko, die der Senat in seinem Urteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22 für überhöhte Kostenansätze einer Werkstatt für die Reparatur des beschädigten Fahrzeugs fortentwickelt hat, auch auf überhöhte Kostenansätze eines Kfz-Sachverständigen anwendbar, den der Geschädigte mit der Begutachtung seines Fahrzeugs zur Ermittlung des unfallbedingten Schadens beauftragt hat.
a) Übergibt der Geschädigte das beschädigte Fahrzeug an eine Fachwerkstatt zur Instandsetzung, ohne dass ihn insoweit ein (insbesondere Auswahl- oder Überwachungs-) Verschulden trifft, so sind dadurch anfallende Reparaturkosten im Verhältnis des Geschädigten zum Schädiger aufgrund der subjektbezogenen Schadensbetrachtung auch dann vollumfänglich ersatzfähig, wenn sie etwa wegen überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise der Werkstatt unangemessen, mithin nicht erforderlich im Sinne von § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sind; in einem solchen Fall gegebenenfalls bestehende Ansprüche des Geschädigten gegen den Werkstattbetreiber spielen nur insoweit eine Rolle, als der Schädiger im Rahmen des Vorteilsausgleichs deren Abtretung verlangen kann. Das Werkstattrisiko verbleibt in diesem Fall - wie bei § 249 Abs. 1 BGB - auch im Rahmen des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB im Verhältnis des Geschädigten zum Schädiger beim Schädiger (st. Rspr.; Senatsurteile vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 14; vom 26. April 2022 - VI ZR 147/21, NJW 2022, 2840 Rn. 12 mwN; vom 29. Oktober 1974 - VI ZR 42/73, BGHZ 63, 182, 184, juris Rn. 9 ff.).
Dies gilt für alle Mehraufwendungen der Schadensbeseitigung, deren Entstehung dem Einfluss des Geschädigten entzogen ist und die ihren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten nicht kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Ersatzfähig sind danach nicht nur solche Rechnungspositionen, die ohne Schuld des Geschädigten etwa wegen überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise unangemessen, mithin nicht zur Herstellung erforderlich im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sind. Ersatzfähig im Verhältnis des Geschädigten zum Schädiger sind vielmehr auch diejenigen Rechnungspositionen, die sich auf - für den Geschädigten nicht erkennbar - tatsächlich nicht durchgeführte einzelne Reparaturschritte und -maßnahmen beziehen (Senatsurteile vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 16 und - VI ZR 239/22, juris Rn. 14).
b) Diese Grundsätze lassen sich auf die Kosten der Begutachtung eines verunfallten Fahrzeugs zur Schadensermittlung übertragen. Den Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten des Geschädigten sind nicht nur in dem werkvertraglichen Verhältnis mit einer Reparaturwerkstatt, sondern auch in dem werkvertraglichen Verhältnis mit einem Kfz-Sachverständigen Grenzen gesetzt, vor allem, sobald er den Gutachtensauftrag erteilt und das Fahrzeug in die Hände des Gutachters gegeben hat. Auch im Rahmen der Schadensermittlung als Vorstufe der Schadensbeseitigung können Mehraufwendungen anfallen, deren Entstehung dem Einfluss des Geschädigten entzogen ist und die ihren Grund darin haben, dass die Schadensermittlung in einer fremden, vom Geschädigten nicht kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Ersatzfähig im Verhältnis des Geschädigten zum Schädiger sind demnach auch im Bereich der Schadensermittlung diejenigen Rechnungspositionen, die ohne Schuld des Geschädigten etwa wegen überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise unangemessen, mithin nicht zur Herstellung erforderlich im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sind. Bei einem Kfz-Sachverständigen, der sein Grundhonorar nicht nach Stunden, sondern nach Schadenshöhe berechnet (vgl. dazu Senatsurteile vom 24. Oktober 2017 - VI ZR 61/17, NJW 2018, 693 Rn. 24; vom 23. Januar 2007 - VI ZR 67/06, VersR 2007, 560 Rn. 20; BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 122/05, BGHZ 167, 139 Rn. 18), kommt ein für den Geschädigten nicht erkennbar überhöhter Ansatz beispielsweise auch dann in Betracht, wenn der Gutachter den Schaden unzutreffend zu hoch einschätzt (vgl. dazu Senatsurteil vom 24. Oktober 2017 - VI ZR 61/17, NJW 2018, 693 Rn. 25). Diesbezügliche Mehraufwendungen sind dann ebenfalls ersatzfähig, ebenso Rechnungspositionen, die sich auf - für den Geschädigten nicht erkennbar - tatsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Begutachtung beziehen. Auch hier kann aber der Schädiger im Rahmen des Vorteilsausgleichs die Abtretung gegebenenfalls bestehender Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen verlangen.
c) Freilich führen diese Grundsätze nicht dazu, die Rechnung des Sachverständigen dem nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB für die Begutachtung geschuldeten Betrag ungeprüft gleichzusetzen. So müssen die Kosten der Begutachtung unfallbedingt sein (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 18). Ferner dürfen an den vom Geschädigten zu führenden Nachweis, dass er wirtschaftlich vorgegangen ist, also bei der Beauftragung, aber auch bei der Überwachung des Sachverständigen den Interessen des Schädigers an Geringhaltung des Schadensermittlungsaufwandes Rechnung getragen hat, nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 19). So trifft den Geschädigten eine Obliegenheit zu einer gewissen Plausibilitätskontrolle der vom Sachverständigen bei Vertragsschluss geforderten bzw. später berechneten Preise. Verlangt der Sachverständige bei Vertragsschluss Preise, die - für den Geschädigten erkennbar - deutlich überhöht sind, kann sich die Beauftragung dieses Sachverständigen als nicht erforderlich im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB erweisen (Auswahlverschulden). Ein Überwachungsverschulden kommt beispielsweise in Betracht, wenn die Rechnung - für den Geschädigten erkennbar - von der Honorarvereinbarung abweicht oder wenn der Sachverständige für den Geschädigten erkennbar überhöhte Nebenkosten angesetzt hat (vgl. Senatsurteile vom 24. Oktober 2017 - VI ZR 61/17, NJW 2018, 693 Rn. 27; vom 26. April 2016 - VI ZR 50/15, VersR 2016, 1133 Rn. 14). Der Geschädigte kann dann nur Ersatz der für die Erstattung des Gutachtens tatsächlich erforderlichen Kosten verlangen, deren Höhe der Tatrichter gemäß § 287 ZPO zu bemessen hat (vgl. Senatsurteil vom 7. Februar 2023 - VI ZR 137/22, NJW 2023, 1718 Rn. 54 mwN).
d) Die Anwendung der genannten Grundsätze zum Werkstattrisiko auf die Sachverständigenkosten setzt nicht voraus, dass der Geschädigte die Rechnung des Sachverständigen bereits bezahlt hat. Soweit der Geschädigte die Rechnung nicht beglichen hat, kann er - will er das Werkstattrisiko bzw. hier das Sachverständigenrisiko nicht selbst tragen - die Zahlung der Sachverständigenkosten allerdings nicht an sich, sondern nur an den Sachverständigen verlangen, Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger (dieses Risiko betreffender) Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen. Es gelten auch insoweit dieselben Grundsätze wie für die Instandsetzung des beschädigten Fahrzeugs (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 20 ff.). Soweit der Senat diese Option in seiner bisherigen Rechtsprechung zur Ersatzfähigkeit von Sachverständigenkosten nicht eröffnet hat, hält der Senat an dieser Rechtsprechung nicht fest.
aa) Hat der Geschädigte die Rechnung des Sachverständigen nicht (vollständig) beglichen, so ist zu berücksichtigen, dass ein Vorteilsausgleich durch Abtretung etwaiger Gegenansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen an den Schädiger aus Rechtsgründen nicht gelingen kann, wenn der Geschädigte auch nach Erhalt der Schadensersatzleistung vom Schädiger von der (Rest-)Zahlung an den Sachverständigen absieht. Zur Begründung wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22 (juris Rn. 22-24) verwiesen, die hier entsprechend gelten.
bb) Aus diesem Grund kann der Geschädigte, der sich auf das Sachverständigenrisiko beruft, aber die Rechnung des Sachverständigen noch nicht (vollständig) bezahlt hat, von dem Schädiger Zahlung des von dem Sachverständigen in Rechnung gestellten (Rest-)Honorars nur an den Sachverständigen und nicht an sich selbst verlangen, Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger (das Sachverständigenrisiko betreffender) Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 25; zum Schadensersatzanspruch des Geschädigten gegen den Sachverständigen wegen Aufklärungspflichtverletzung bei überhöhtem Honorar vgl. BGH, Urteil vom 1. Juni 2017 - VII ZR 95/16, BGHZ 215, 306 Rn. 24 ff.). Nur so stellt er sicher, dass sich der Schädiger und nicht er selbst über unangemessene bzw. unberechtigte Rechnungsposten mit dem Sachverständigen auseinanderzusetzen hat.
(Vollstreckungs-)Gläubiger bleibt auch in diesem Fall allein der Geschädigte. Der Sachverständige erhält lediglich eine Empfangszuständigkeit (zur Rechtskraftwirkung und zum Regress des Schädigers gegenüber dem Sachverständigen vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 26).
e) Wählt der Geschädigte bei unbezahlter Rechnung hingegen - auch nach gerichtlichem Hinweis - Zahlung an sich selbst, so trägt er und nicht der Schädiger das Sachverständigenrisiko. Er hat dann im Schadensersatzprozess gegen den Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer gegebenenfalls zu beweisen, dass die abgerechneten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Begutachtung tatsächlich durchgeführt wurden und dass die Begutachtungskosten nicht etwa wegen überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit, wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise des Sachverständigen oder - bei Berechnung des Honorars nach der Höhe des Schadens - wegen unzutreffender Schadensermittlung nicht erforderlich sind (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 27).
f) Schließlich stünde es dem Geschädigten im Rahmen von § 308 Abs. 1 ZPO frei, vom Schädiger statt Zahlung Befreiung von der Verbindlichkeit gegenüber dem Sachverständigen zu verlangen. In diesem Fall richtete sich sein Anspruch grundsätzlich und bis zur Grenze des Auswahl- und Überwachungsverschuldens danach, ob und in welcher Höhe er mit der Verbindlichkeit, die er gegenüber dem Sachverständigen eingegangen ist, beschwert ist. Es wäre also die Berechtigung der Forderung, von der freizustellen ist, und damit die werkvertragliche Beziehung zwischen Geschädigtem und Sachverständigen maßgeblich (Senatsurteil vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21, NJW 2023, 1057 Rn. 12 mwN; vgl. auch BGH, Urteil vom 16. November 2006 - I ZR 257/03, NJW 2007, 1809 Rn. 20). Auch in diesem Fall trüge der Geschädigte das Sachverständigenrisiko somit selbst (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 253/22, juris Rn. 28).
6. Hat sich der Sachverständige, wie hier die Klägerin, die Schadensersatzforderung des Geschädigten in Höhe der Honorarforderung abtreten lassen, kann er sich als Zessionar allerdings nicht auf das Sachverständigenrisiko berufen. Die diesbezüglich im Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 239/22 (juris Rn. 23-25) entwickelten Grundsätze gelten entsprechend für den Sachverständigen:
a) Nach § 399 Alt. 1 BGB kann eine Forderung nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann. Eine solche Inhaltsänderung wird auch dann angenommen, wenn ein Gläubigerwechsel zwar rechtlich vorstellbar, das Interesse des Schuldners an der Beibehaltung einer bestimmten Gläubigerposition aber besonders schutzwürdig ist (st. Rspr., vgl. BGH, Urteile vom 8. April 2020 - VIII ZR 130/19, NJW-RR 2020, 779 Rn. 76; vom 30. Oktober 2009 - V ZR 42/09, NJW 2010, 1074 Rn. 27; vom 24. Oktober 1985 - VII ZR 31/85, BGHZ 96, 146, 148 f., juris Rn. 16 f.; vgl. ferner Kieninger in MünchKomm BGB, 9. Aufl., § 399 Rn. 24; Rn. 22; Staudinger/Busche, BGB [2022], § 399 Rn. 22; jeweils mwN).
Dieser Rechtsgedanke greift hier insofern Platz, als sich der Geschädigte im Verhältnis zum Schädiger auch bei unbeglichener Rechnung auf das Sachverständigenrisiko berufen kann, wenn er Zahlung an den Sachverständigen verlangt. Denn insoweit hat der Schädiger ein besonders schutzwürdiges Interesse daran, dass der Geschädigte sein Gläubiger bleibt. Allein im Verhältnis zu diesem ist nämlich die Durchführung des Vorteilsausgleichs in jedem Fall möglich, weil der Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger und die im Wege des Vorteilsausgleichs abzutretenden - etwaigen - Ansprüche gegen den Sachverständigen in einer Hand (beim Geschädigten) liegen. Dies ist nach der Abtretung der Schadensersatzforderung an den Sachverständigen nicht mehr der Fall. Der Schädiger verlöre daher regelmäßig das Recht, seine eigene Zahlungsverpflichtung nur Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen zu erfüllen. Bei einer - wie hier - erfolgten Abtretung an den Sachverständigen ist bei wertender Betrachtung zudem in den Blick zu nehmen, dass die Grundsätze zum Sachverständigenrisiko nach ihrer dogmatischen Herleitung nur dem Geschädigten, nicht aber dem Sachverständigen selbst zugutekommen sollen (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 239/22, juris Rn. 23 f.).
b) Nach all dem lässt sich die Option des Geschädigten, sich auch bei unbeglichener Rechnung auf das Sachverständigenrisiko zu berufen, nicht im Wege der Abtretung auf Dritte übertragen. Im Ergebnis trägt daher bei Geltendmachung des Anspruchs aus abgetretenem Recht stets der Zessionar das Sachverständigenrisiko. Im Schadensersatzprozess gegen den Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer hat folglich der Zessionar - hier der klagende Sachverständige - darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass die abgerechneten Maßnahmen im Rahmen der Begutachtung tatsächlich durchgeführt wurden und dass die geltend gemachten Begutachtungskosten nicht etwa wegen überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit, wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise des Sachverständigen oder - bei Berechnung des Honorars nach der Höhe des Schadens - wegen unzutreffender Schadensermittlung nicht erforderlich waren (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 239/22, juris Rn. 25).
c) Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin, die aus abgetretenem Recht des Geschädigten vorgeht, darzulegen und ggf. zu beweisen, dass die mit der Pauschale abgerechneten Corona-Schutzmaßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden und objektiv erforderlich waren (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 2024 - VI ZR 51/23, juris Rn. 18) und dass die Pauschale auch ihrer Höhe nach nicht über das Erforderliche hinausgeht.
Mit der Begründung des Berufungsgerichts kann der Anspruch auf Erstattung der Corona-Pauschale allerdings nicht verneint werden.
aa) Entgegen der nicht näher begründeten Ansicht des Berufungsgerichts fehlt es nicht an der (haftungsausfüllenden) Kausalität zwischen der unfallbedingten Beschädigung des Fahrzeugs und etwaigen im Rahmen der Begutachtung durchgeführten Corona-Schutzmaßnahmen. Die unfallbedingte Beschädigung des Fahrzeugs kann nicht im Sinne der Äquivalenztheorie hinweggedacht werden, ohne dass die Begutachtung zur Schadensermittlung und die dabei durchgeführten Corona-Schutzmaßnahmen entfielen. Erfolgte - wie hier - die Begutachtung während der Corona-Pandemie, war die Durchführung von Corona-Schutzmaßnahmen im Rahmen der Begutachtung grundsätzlich auch adäquat-kausal.
bb) Bei der Beurteilung, ob die durchgeführten Corona-Schutzmaßnahmen objektiv erforderlich waren, ist zu berücksichtigen, dass einem Sachverständigen als Unternehmer gewisse Entscheidungsspielräume hinsichtlich seines individuellen Hygienekonzepts während der Corona-Pandemie zuzugestehen sind (vgl. Senatsurteil vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21, NJW 2023, 1057 Rn. 16). Dabei geht es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht nur um den Schutz des Sachverständigen und seiner Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, sondern auch um den Schutz, den der Auftraggeber der jeweiligen Begutachtung während der Pandemie im Hinblick auf Maßnahmen, die in seinem Fahrzeug durchgeführt werden, üblicherweise bzw. aufgrund der Gepflogenheiten während der Pandemie erwarten darf; diesen Erwartungen zu entsprechen ist ein berechtigtes Anliegen des Sachverständigen.
cc) Es begegnet entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts keinen grundsätzlichen Bedenken, dass die Klägerin die Corona-Pauschale gesondert berechnet hat. Einem Kfz-Sachverständigen steht es frei, neben einem Grundhonorar für seine eigentliche Sachverständigentätigkeit Nebenkosten, auch in Form von Pauschalen, für tatsächlich angefallene Aufwendungen abzurechnen (vgl. Senatsurteil vom 24. Oktober 2017 - VI ZR 61/17, NJW 2018, 693 Rn. 27; BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 80/05, NJW-RR 2007, 56 Rn. 20). Die betriebswirtschaftliche Entscheidung, ob die für das Hygienekonzept in der Corona-Pandemie anfallenden Kosten gesondert ausgewiesen oder als interne Kosten in die Kalkulation des Grundhonorars "eingepreist" werden, steht dabei grundsätzlich dem Sachverständigen als Unternehmer zu; es darf nur nicht beides kumulativ erfolgen. Angesichts der nur vorübergehenden Natur jedenfalls der verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie mag es sogar ein Ausdruck des Bemühens um Kostentransparenz sein, die Pauschale für die Dauer ihres Anfallens gesondert auszuweisen (Senatsurteil vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21, NJW 2023, 1057 Rn. 16; vgl. BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 80/05, NJW-RR 2007, 56 Rn. 20).
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist es unerheblich, ob nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen mit dem Grundhonorar abgegolten sein sollen oder gesondert abgerechnet werden dürfen. Denn eine Übertragung der Grundsätze des JVEG für die Vergütung gerichtlicher Sachverständiger auf Privatgutachter scheidet grundsätzlich aus (vgl. Senatsurteil vom 23. Januar 2007 - VI ZR 67/06, VersR 2007, 560 Rn. 21; BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 122/05, BGHZ 167, 139 Rn. 19). Zwar darf der Tatrichter, wenn ein Privatgutachter überhöhte Nebenkosten abgerechnet hat, zur Schätzung der tatsächlich erforderlichen Kosten nach § 287 ZPO als Orientierungshilfe die Bestimmungen des JVEG oder geeignete Listen heranziehen (Senatsurteile vom 26. April 2016 - VI ZR 50/15, NJW 2016, 3092 Rn. 18 ff., 26; vom 24. Oktober 2017 - VI ZR 61/17, NJW 2018, 693 Rn. 29 f.). Das bedeutet aber nicht, dass nur deshalb, weil das JVEG oder Listen wie die BVSK-Honorarbefragung bestimmte Nebenkosten nicht ausweisen, diese nicht abgerechnet werden dürfen.
dd) Für die Frage der Erforderlichkeit der in Rechnung gestellten Corona-Pauschale im Sinne von § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB kommt es entgegen der Ansicht beider Parteien im Streitfall nicht darauf an, ob und in welcher Höhe hierfür werkvertraglich eine Vergütung geschuldet ist. Dies spielte nur dann eine Rolle, wenn Streitgegenstand ein Anspruch des Geschädigten auf Befreiung von der Verbindlichkeit gegenüber dem Sachverständigen wäre, wie es in dem dem Senatsurteil vom 13. Dezember 2022 - VI ZR 324/21 (NJW 2023, 1057) zugrundeliegenden Sachverhalt der Fall war (siehe oben unter 5. f). Darum geht es vorliegend aber nicht.
III.
Das Berufungsurteil war daher aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 562 Abs. 1, § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
BGH, Urteil vom 12. März 2024 - VI ZR 280/22
Ihre Spezialisten zum Thema
Verkehrsrecht