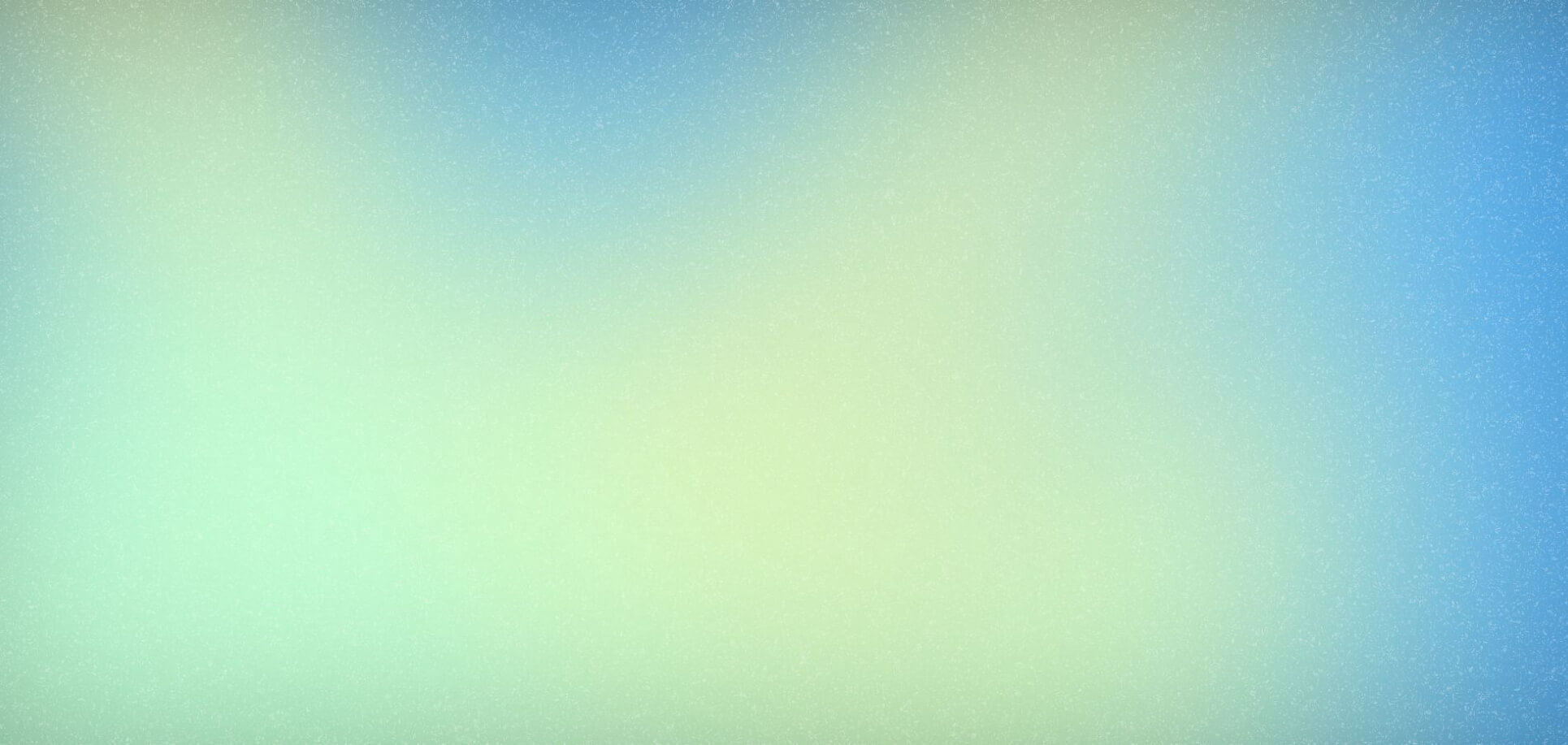Bundesgerichtshof zur Haftung des Betreibers einer Waschanlage
Der unter anderem für das Werkvertragsrecht zuständige VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über die Haftung des Betreibers einer Autowaschanlage für einen Fahrzeugschaden entschieden (Urteil vom 21. November 2024 - VII ZR 39/24 ).
Sachverhalt und bisheriger Prozessverlauf
Der Kläger verlangt Schadensersatz wegen der Beschädigung seines Fahrzeugs in einer von der Beklagten betriebenen Autowaschanlage, einer sogenannten Portalwaschanlage.
In der Waschanlage befindet sich ein Hinweisschild, das auszugsweise wie folgt lautet:
"Allgemeine Geschäftsbedingungen Autowaschanlagen/Portalwaschanlagen
Die Reinigung der Fahrzeuge in der Waschanlage erfolgt unter Zugrundelegung der nachfolgenden Bedingungen: (…).
Die Haftung des Anlagenbetreibers entfällt insbesondere dann, wenn ein Schaden durch nicht ordnungsgemäß befestigte Fahrzeugteile oder durch nicht zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile (z.B. Spoiler, Antenne, Zierleisten o.ä.) sowie dadurch verursachte Lackkratzer verursacht worden ist, außer den Waschanlagenbetreiber oder sein Personal trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz."
Unter diesem Hinweisschild befindet sich ein Zettel mit der Aufschrift:
"Achtung Keine Haftung für Anbauteile und Heckspoiler!".
Der Kläger fuhr Ende Juli 2021 mit seinem Pkw der Marke Land Rover in die Waschanlage ein, stellte das Fahrzeug ordnungsgemäß ab, verließ die Waschhalle und startete den Waschvorgang. Während des Waschvorgangs wurde der zur serienmäßigen Fahrzeugausstattung gehörende, an der hinteren Dachkante angebrachte Heckspoiler abgerissen, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde. Deswegen verlangt der Kläger von der Beklagten Schadensersatz in Höhe von insgesamt 3.219,31 €, eine Nutzungsausfallentschädigung (119 €) für den Tag der Fahrzeugreparatur sowie die Freistellung von Rechtsanwaltskosten.
Das Amtsgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Die Revision des Klägers war erfolgreich. Sie führte zur Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils.
Dem Kläger steht wegen der Beschädigung seines Fahrzeugs gegen die Beklagte ein vertraglicher Schadensersatzanspruch in der geltend gemachten Höhe zu. Der Vertrag über die Reinigung eines Fahrzeugs umfasst als Nebenpflicht die Schutzpflicht des Waschanlagenbetreibers, das Fahrzeug des Kunden vor Beschädigungen beim Waschvorgang zu bewahren. Geschuldet sind diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Anlagenbetreiber für notwendig und ausreichend halten darf, um andere vor Schäden zu bewahren. Hierbei trägt grundsätzlich der Gläubiger die Beweislast dafür, dass der Schuldner eine ihm obliegende Pflicht verletzt und diese Pflichtverletzung den Schaden verursacht hat. Abweichend davon hat sich allerdings der Schädiger nicht nur hinsichtlich seines Verschuldens zu entlasten, sondern muss er auch darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass ihn keine Pflichtverletzung trifft, wenn die für den Schaden in Betracht kommenden Ursachen allein in seinem Obhuts- und Gefahrenbereich liegen.
Ein solcher Fall ist hier gegeben. Die Ursache für die Beschädigung des klägerischen Fahrzeugs liegt allein im Obhuts- und Gefahrenbereich der Beklagten. Nach den außer Streit stehenden Feststellungen des Berufungsgerichts kam es zu der Beschädigung, weil die Waschanlage konstruktionsbedingt nicht für das serienmäßig mit einem Heckspoiler ausgestattete Fahrzeug des Klägers geeignet war. Das Risiko, dass eine Autowaschanlage für ein marktgängiges Fahrzeug wie dasjenige des Klägers mit einer serienmäßigen Ausstattung wie dem betroffenen Heckspoiler konstruktionsbedingt nicht geeignet ist, fällt in den Obhuts- und Gefahrenbereich des Anlagenbetreibers.
Daneben kommt keine aus dem Obhuts- und Gefahrenbereich des Klägers stammende Ursache für den Schaden in Betracht. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war das Fahrzeug des Klägers vor dem Einfahren in die Waschanlage unbeschädigt und der serienmäßige Heckspoiler ordnungsgemäß angebracht sowie fest mit dem Fahrzeug verbunden. Der Kläger, dem mit seinem marktgängigen, serienmäßig ausgestatteten und in ordnungsgemäßem Zustand befindlichen Fahrzeug von der Beklagten als Betreiberin die Nutzung der Waschanlage eröffnet wurde, konnte berechtigt darauf vertrauen, dass sein Fahrzeug so, wie es ist, also mitsamt den serienmäßig außen angebrachten Teilen, unbeschädigt aus dem Waschvorgang hervorgehen werde. Dieses Vertrauen war insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Risikobeherrschung gerechtfertigt, weil nur der Anlagenbetreiber Schadensprävention betreiben kann, wohingegen der Kunde regelmäßig sein Fahrzeug der Obhut des Betreibers überantwortet, ohne die weiteren Vorgänge selbst beeinflussen zu können. Anders als der Betreiber, der es in der Hand hat, bestimmte Fahrzeugmodelle, die er für schadensanfällig hält, von der Benutzung seiner Anlage auszuschließen und dadurch das Risiko einer Beschädigung zu verringern, ist es dem Kunden regelmäßig nicht möglich, solche Waschanlagen von vornherein zu identifizieren und zu meiden, die konstruktionsbedingt nicht geeignet sind, sein Fahrzeug ohne ein erhöhtes Schadensrisiko zu reinigen.
Die hiernach gegen sie streitende Vermutung der Pflichtverletzung hat die Beklagte nicht widerlegt und den ihr obliegenden Nachweis fehlenden Verschuldens nicht geführt. Ihr Vortrag, die Gefahr der Schädigung des serienmäßig angebrachten Heckspoilers sei ihr nicht bekannt gewesen, weil sich ein solcher Vorfall bislang in der Waschanlage nicht ereignet habe, sie habe diese Gefahr auch nicht kennen müssen und hierfür keine konkreten Anhaltspunkte gehabt, eine hypothetische Erkundigung hätte zudem an dem konkreten Schadensereignis nichts geändert, genügt zu ihrer Entlastung nicht. Es fehlt schon an der Darlegung, ob die Beklagte - die sich ausweislich der in der Waschanlage angebrachten Schilder der Gefahr einer Beschädigung insbesondere von Heckspoilern grundsätzlich bewusst war - sich darüber informiert hat, für welche Fahrzeuge ihre Anlage konstruktionsbedingt ungeeignet ist und daher ein erhöhtes Schadensrisiko besteht. Ebenso wenig ist dargetan, dass sie keine Informationen bekommen hätte, auf deren Grundlage die Beschädigung des klägerischen Fahrzeugs vermieden worden wäre.
Die Beklagte hat sich ferner nicht durch einen ausreichenden Hinweis auf die mit dem Waschvorgang verbundenen Gefahren entlastet. Das in der Waschanlage angebrachte, mit "Allgemeine Geschäftsbedingungen Autowaschanlagen/Portalwaschanlagen" überschriebene Schild reicht als Hinweis schon deshalb nicht aus, weil es ausdrücklich nur "nicht ordnungsgemäß befestigte Fahrzeugteile oder (…) nicht zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile (z.B. Spoiler…)" erwähnt. Nicht nur fällt der Heckspoiler des klägerischen Fahrzeugs nicht hierunter, weil er zur Serienausstattung gehört und ordnungsgemäß befestigt war, sondern die ausdrückliche Beschränkung auf nicht serienmäßige Fahrzeugteile ist sogar geeignet, bei dem Nutzer das Vertrauen zu begründen, mit einem serienmäßig ausgestatteten Pkw die Anlage gefahrlos benutzen zu können. Ebenso wenig stellt der darunter befindliche Zettel mit der Aufschrift "Keine Haftung für Anbauteile und Heckspoiler!" einen ausreichenden Hinweis dar. Angesichts des darüber befindlichen Schildes mit der ausdrücklichen Beschränkung auf nicht zur Serienausstattung gehörende Teile wird für den Waschanlagennutzer schon nicht hinreichend klar, dass - gegebenenfalls - von diesem Hinweis auch die Nutzung der Waschanlage durch Fahrzeuge mit serienmäßigem Heckspoiler erfasst sein soll.
Vorinstanzen:
AG Ibbenbüren - Urteil vom 20. Dezember 2022 - 3 C 268/21
LG Münster - Urteil vom 14. Februar 2024 - 1 S 4/23
BGH VII ZR 39/24
Ihre Spezialisten zum Thema
Verkehrsrecht

Aus der Praxis.
Aktuell informiert.
Mietrecht
2026
Einstweiliger Rechtsschutz zeigt Wirkung – Vermieterin entfernt eigenmächtig angebrachte Schlösser
Mit Beschluss vom 14.08.2025 (Az. 1 C 124/25) hat das Amtsgericht Philippsburg in einem von unserer Kanzlei geführten Verfahren die Kosten der Vermieterin auferlegt. Rechtsanwalt Gier vertrat die Verfügungskläger erfolgreich.
Hintergrund des Falls war, dass die Vermieterin Anfang August 2025 ohne Vorankündigung den direkten Zugang zu den im Keller gelegenen Gemeinschaftsräumen (Waschküche und Trockenplatz) versperrt hatte. Hierzu brachte sie Gittertüren mit Ketten und Vorhängeschlössern an. Die Mieter waren dadurch faktisch von der Nutzung ausgeschlossen – obwohl die Mitbenutzung dieser Räume seit Jahrzehnten vertraglich vereinbart war.
Unsere Kanzlei reagierte umgehend mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, um die sofortige Wiedereinräumung des Mitbesitzes durchzusetzen. Noch bevor das Gericht über den Antrag entscheiden musste, entfernte die Vermieterin nach Zustellung der Antragsschrift die Schlösser und gab den Zugang wieder frei.
Daraufhin erklärten wir den Rechtsstreit für erledigt. Die Gegenseite übernahm die Kosten des Verfahrens, was das Gericht mit Beschluss vom 14.08.2025 bestätigte.
Der Fall zeigt anschaulich: Vermieter dürfen den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache nicht eigenmächtig einschränken. Wer ohne Rechtsgrund verschließt oder den Zugang zu Gemeinschaftsräumen blockiert, setzt sich dem Vorwurf verbotener Eigenmacht aus und muss mit sofortigen gerichtlichen Schritten rechnen. Für Mieter bedeutet dies, dass sie nicht schutzlos gestellt sind – bereits ein schneller Antrag auf einstweilige Verfügung kann Vermieter dazu bewegen, ihr rechtswidriges Verhalten sofort zu beenden.
Fazit: Auch wenn es hier keiner inhaltlichen Entscheidung des Gerichts bedurfte, hat das Verfahren deutlich gemacht: Eigenmächtige Eingriffe durch Vermieter haben im Mietrecht keinen Platz. Mit entschlossenem Vorgehen lassen sich Mieterrechte wirksam und zeitnah sichern.
Praxis-Tipp für Mieter: Wenn Vermieter plötzlich den Zugang zu mitvermieteten Räumen oder Gemeinschaftsflächen versperren, sollten betroffene Mieter schnell reagieren. Wichtig ist, die Situation unmittelbar zu dokumentieren – etwa durch Fotos oder Zeugen – und den Vermieter nachweisbar zur sofortigen Beseitigung der Sperre aufzufordern. Erfolgt keine Abhilfe, kann eine einstweilige Verfügung beantragt werden, mit der sich der rechtmäßige Besitz kurzfristig sichern lässt. Schnelles Handeln ist entscheidend, um die eigenen Rechte effektiv zu wahren.
Mietrecht
2026
Wenn Nachbarn zu weit gehen
Gericht stärkt Persönlichkeitsrechte gegen unerwünschte Videoüberwachung
Das Thema Überwachung durch privat installierte Kameras sorgt regelmäßig für Streit unter Nachbarn. In einem aktuellen Verfahren, das von Rechtsanwalt Gier betreut wurde, ist nun ein wegweisendes Urteil ergangen. Das Amtsgericht Bruchsal hat am 14.10.2025 (Az. 4 C 106/23) unsere Mandanten in ihrem Recht auf Schutz der Privatsphäre gestärkt und die unerwünschte Videoüberwachung durch den Nachbarn untersagt.
Im zugrunde liegenden Fall lebten unsere Mandanten in einer Reihenhausanlage, gemeinsam mit dem beklagten Nachbarn, der an seinem Haus mehrere Überwachungskameras angebracht hatte. Zwischen den Parteien bestand bereits eine länger schwelende Nachbarschaftsstreitigkeit, die sich unter anderem um die Nutzung und Gestaltung der Grundstücke drehte. Die Installation der Kameras führte zu erheblicher Verunsicherung bei unseren Mandanten, da technisch die Möglichkeit bestand, dass deren Grundstück und Garten überwacht wurden. Obwohl der Nachbar behauptete, seine Kameras würden ausschließlich sein eigenes Grundstück filmen, konnte durch ein Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen nachgewiesen werden, dass die Kameras tatsächlich so ausgerichtet werden konnten (und teils auch waren), dass sie Bereiche unserer Mandanten erfassten. Besonders problematisch war die Möglichkeit, dass die Kameras per App unbemerkt aus der Ferne gesteuert werden konnten. Der rechtliche Streit drehte sich zentral um die Frage, inwieweit Eigentümer von Nachbargrundstücken solcher Überwachung und sogar dem damit verbundenen Überwachungsdruck ausgesetzt sein müssen.
Das Gericht hat ausgesprochen deutlich gemacht, dass bereits der objektiv begründete Eindruck einer potentiellen Überwachung – der sogenannte Überwachungsdruck – eine unzumutbare Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darstellt, selbst wenn gar keine dauerhafte oder aktuelle Aufzeichnung erfolgt. Maßgeblich ist dabei, ob Betroffene ernsthaft befürchten müssen, gefilmt zu werden. Insofern hat das Gericht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestätigt und weiter konkretisiert: Es kommt nicht darauf an, wie der Kamerawinkel in einem bestimmten Moment eingestellt ist; entscheidend ist vielmehr, welche technische Möglichkeit und damit verbundene Unsicherheit besteht. So genügt es, dass eine Kamera unbemerkt auf das Nachbargrundstück gerichtet werden kann, um einen Unterlassungsanspruch zu begründen. Das Gericht betonte zudem, dass das Interesse am Schutz des Eigentums durch Kameras das Persönlichkeitsrecht Dritter allenfalls dann überwiegt, wenn ausschließlich das eigene Grundstück erfasst wird. Sobald aber – wie im vorliegenden Fall – die Möglichkeit der Überwachung fremder Grundstücksteile besteht, ist die Installation und der Betrieb solcher Kameras unzulässig. Folge dieses Urteils war nicht nur die Verpflichtung zur Entfernung der Kameras, sondern auch die Androhung erheblichen Ordnungsgelds für den Fall erneuter Zuwiderhandlung.
Für die Praxis bedeutet dieses Urteil eine klare Stärkung der Rechte von Hauseigentümern und Mietern, die sich gegen die Überwachung durch Nachbarn zur Wehr setzen möchten. Es genügt nicht, dass der Kamerabetreiber versichert, niemanden überwachen zu wollen: Allein die Möglichkeit der Ausrichtung auf fremde Bereiche reicht schon aus, um einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht zu begründen – insbesondere bei angespannten Nachbarschaftsverhältnissen. Personen, die sich durch eine Kamera ihres Nachbarn beeinträchtigt fühlen, sollten daher nicht zögern, ihren Unterlassungsanspruch geltend zu machen. Umgekehrt ist Eigentümern, die ihr Grundstück mit Kameras schützen wollen, dringend anzuraten, die technische Ausrichtung und Reichweite so zu wählen, dass keinerlei Zweifel an einer ausschließlichen Überwachung des eigenen Grundstücks bestehen.
Das Urteil unterstreicht, wie wichtig sorgsame anwaltliche Begleitung bei Nachbarschaftskonflikten ist. Für unsere Mandanten war es maßgeblich, dass mithilfe eines Sachverständigengutachtens und gezielter Beweiserhebung die tatsächliche Gefahr (und der Eindruck) einer Überwachung belegt werden konnte. Unsere Kanzlei hat mit diesem Verfahren nicht nur zum Schutz der Privatsphäre unserer Mandanten beigetragen, sondern auch dazu, dass rechtliche Klarheit und Sicherheit für vergleichbare Fälle geschaffen wurde. Wir beraten Sie gerne, sollten Sie Fragen zu solchen Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dem Einsatz privater Videoüberwachung haben.
Verkehrsrecht
2025
Totalschaden – und jetzt? Warum Sie Ihr Unfallfahrzeug schnell und klug veräußern sollten
Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist belastend – aber er eröffnet auch klare Handlungsmöglichkeiten. Wer zügig und richtig vorgeht, vermeidet Streit mit der gegnerischen Versicherung, reduziert Folgekosten (z. B. Stand- und Transportkosten) und beschleunigt die Auszahlung. Entscheidend ist: Lassen Sie ein belastbares Gutachten erstellen, in dem der Sachverständige drei konkrete Restwertangebote vom allgemeinen regionalen Markt einholt – und verwenden Sie für die Veräußerung den höchsten dieser drei Werte. Dokumentieren Sie den Verkauf schriftlich. Wurde Ihr Fahrzeug abgeschleppt, fragen Sie das Abschleppunternehmen, ob ein Ankauf zum höchsten regionalen Restwert möglich ist; so können Sie teure Weitertransporte vermeiden und die Abwicklung spürbar vereinfachen. Diese Vorgehensweise entspricht der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Wirtschaftlichkeitsgebot und zur subjektbezogenen Schadensbetrachtung.
Die drei Grundpfeiler: Wirtschaftlichkeitsgebot, regionaler Markt, drei Restwertangebote
Wirtschaftlichkeitsgebot: Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB muss der Geschädigte den wirtschaftlich vernünftigen Weg der Schadensbehebung wählen. Das gilt ausdrücklich auch für die Verwertung des Unfallfahrzeugs (Restwert). Der Bundesgerichtshof (BGH) betont, dass die Schadensersatzpflicht „von vornherein nur insoweit“ besteht, als sich die Verwertung im Rahmen wirtschaftlicher Vernunft hält. Zugleich erfolgt die Bewertung subjektbezogen: Es kommt auf Ihre Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten in Ihrer konkreten Lage an.
Allgemeiner regionaler Markt: Der Geschädigte leistet dem Wirtschaftlichkeitsgebot im Regelfall Genüge, wenn er sein Fahrzeug zu dem Preis veräußert, den ein von ihm beauftragter Sachverständiger als Restwert auf dem allgemeinen regionalen Markt ermittelt hat. Eigene Marktforschung überregional oder in Internet-Restwertbörsen schulden Sie grundsätzlich nicht.
Drei konkrete Angebote: Der Sachverständige hat als belastbare Schätzgrundlage regelmäßig drei Restwertangebote einzuholen und im Gutachten konkret zu benennen. Diese Dreizahl entspricht der Empfehlung des 40. Deutschen Verkehrsgerichtstages und ist vom BGH mehrfach bestätigt worden.
Diese drei Eckpfeiler sind in jüngster Zeit erneut vom BGH bekräftigt worden. In der Entscheidung vom 25.03.2025 (VI ZR 174/24) hebt der BGH hervor, dass die Restwertfrage Teil des Wirtschaftlichkeitsgebots ist und die individuelle Situation des Geschädigten zu berücksichtigen bleibt; zugleich genügt der Geschädigte regelmäßig, wenn er auf ein ordnungsgemäßes Gutachten mit konkreter regionaler Restwertermittlung baut.
Schnell handeln – aber richtig: Warum Tempo bei der Veräußerung hilft
Je schneller nach Gutachtenerstellung veräußert wird, desto eher vermeiden Sie Streitpunkte wie Standkosten, Verzögerungen und sich ändernde Marktpreise. Die Rechtsprechung stellt klar, dass Sie grundsätzlich nicht warten müssen, bis die gegnerische Versicherung „vielleicht“ ein höheres Restwertangebot übersendet. Solange ein korrektes, regionales Dreierangebot im Gutachten vorliegt, sind Sie berechtigt, sofort zum gutachterlich ermittelten (höchsten) Restwert zu verkaufen.
Der BGH hat wiederholt betont, dass der Geschädigte nicht verpflichtet ist, den Versicherer vorab um Stellungnahme zu bitten oder überregional/internetbasiert „bessere“ Angebote abzuwarten; die Abwicklung in eigener Regie ist gesetzlich gewollt. Dies wurde u. a. in den Entscheidungen VI ZR 358/18 (2019) und VI ZR 211/22 (2024) betont.
Ein praktisches Gegenbeispiel, wann ausnahmsweise ein Zuwarten geboten sein kann, ist selten – und dann nur, wenn die Versicherung vor dem Verkauf ein konkretes, zumutbares, verbindliches und oft sogar mit kostenloser Abholung verbundenes Höchstangebot vorlegt. Liegt ein solches annahmefähiges, höheres Angebot rechtzeitig vor, kann regelmäßig die Pflicht bestehen, es aus Schadensminderungsgründen zu berücksichtigen. Fehlt es daran, dürfen Sie verkaufen.
Der „Dreiklang“ im Gutachten: Drei regionale Restwertangebote – höchstes Angebot wählen
Warum drei? Die Dreizahl verhindert Zufallsergebnisse („Ausreißer“) und bildet den regionalen Markt zuverlässig ab. Deshalb verlangt der BGH, dass der Sachverständige regelmäßig drei konkrete regionale Angebote einholt und die Anbieter nennt.
Regionalität: Angebote müssen dem für Sie ohne weiteres zugänglichen regionalen Markt entstammen; internetbasierte Spezialbörsen sind regelmäßig kein Muss. Treffen die drei Angebote diese regionalen Anforderungen, genügt es, den höchsten dieser drei Werte als Restwert zugrunde zu legen.
Schriftliche Dokumentation: Halten Sie Angebot, Annahme und Kaufvertrag schriftlich fest (Kaufvertrag mit Datum, Anbieter, Betrag, etwaiger Abholungszusagen). Diese Dokumentation sichert den Nachweis der ordnungsgemäßen, wirtschaftlich vernünftigen Verwertung.
Auch Obergerichte folgen diesem Dreiklang: So hat das OLG Hamm bestätigt, dass der Geschädigte dem Wirtschaftlichkeitspostulat genügt, wenn er eines der drei im Gutachten genannten Restwertangebote – und zwar das höchste – realisiert. Maßgeblich ist der regionale Markt; auf internetbasierte Spezialbörsen kann der Geschädigte regelmäßig nicht verwiesen werden.
Abschleppunternehmen einbinden: Transportkosten vermeiden, Abwicklung erleichtern
Ist Ihr Fahrzeug abgeschleppt worden, lohnt stets die Nachfrage beim Abschleppunternehmen, ob ein Ankauf zum höchsten regionalen Restwert möglich ist. Das ist oft pragmatisch: Es erspart weitergehende Transport- und Standkosten, die sonst die Regulierung belasten können, und beschleunigt die Abwicklung vor Ort. Zudem enthalten manche Restwertangebote – auch aus der Versicherersphäre – ausdrücklich die Zusage einer kostenfreien Abholung; das zeigt, wie bedeutsam Logistik- und Transportkosten in der Restwertpraxis sind. Prüfen Sie daher stets, ob das Abschleppunternehmen die Abholung/Übernahme vor Ort mit abdeckt.
Wichtig: Bleiben Sie beim regionalen Markt. Wenn das Abschleppunternehmen als regionaler Anbieter auftritt und ein in das Dreier-Set passendes, verbindliches Höchstangebot stellt, kann der Verkauf dorthin besonders wirtschaftlich und komfortabel sein. Das beschleunigt die Auszahlung, vermeidet Doppel- oder Weitertransportkosten und hält Sie zugleich auf der sicheren Seite der Rechtsprechung.
Schriftlich verkaufen – warum die Form wichtig ist
Der Verkauf sollte stets schriftlich erfolgen: Es belegt Preis, Datum, Käuferdaten, Abholungsmodalitäten und ggf. die Anrechnung des Restwerts. Diese Klarheit hilft bei der anschließenden Regulierung, insbesondere wenn die Versicherung Fragen zur Höhe des Restwerts stellt oder behauptet, es habe ein höheres (später vorgelegtes) Angebot gegeben. Auch bei einem späteren Streit über den Zugang von Versichererangeboten zeigt eine lückenlose Dokumentation, dass Sie zügig und wirtschaftlich gehandelt haben.
Was gilt, wenn die Versicherung ein höheres Angebot schickt?
Vor dem Verkauf: Erhalten Sie vor der Veräußerung ein konkretes, zumutbares, verbindliches Höchstangebot (typischerweise mit kostenfreier Abholung, klarer Preisangabe und Ansprechpartner), kann ausnahmsweise eine Pflicht bestehen, dieses Angebot anzunehmen (Schadensminderungspflicht). Fehlt es an Verbindlichkeit, Zumutbarkeit oder rechtzeitiger Übermittlung, dürfen Sie zum höchsten regionalen Dreierangebot verkaufen.
Nach dem Verkauf: Haben Sie bereits veräußert, ist der erzielte Restwert maßgeblich. Ein nachträglich übersandtes „höheres“ Angebot bleibt regelmäßig unbeachtlich. Das Risiko, dass nach der Veräußerung andere (später) mehr geboten hätten, trägt grundsätzlich nicht der Geschädigte.
Nur regional und konkret zählt: Mehrfach hat die Rechtsprechung Internet-Höchstgebote verworfen, wenn sie nicht dem regionalen Markt entsprachen. Der BGH verlangt, dass die Restwertermittlung regional erfolgt und der Geschädigte nicht auf einen Sondermarkt im Internet verwiesen wird – es sei denn, besondere Konstellationen (z. B. professionelle Marktteilnehmer) rechtfertigen ausnahmsweise mehr.
Sonderfälle: Leasing, Sicherungsübereignung, gewerbliche Marktkenntnis
Die Rechtsprechung bleibt subjektbezogen: In besonderen Konstellationen – z. B. bei Leasinggeberinnen, Autohaus-Geschädigten oder Sicherungsnehmerinnen (Banken) – können strengere Anforderungen an die Restwertrecherche gelten, insbesondere wenn diese Akteure typischerweise über erweiterte Marktkenntnisse verfügen und ihnen die Nutzung überregionaler oder internetbasierter Restwertbörsen zumutbar ist. In der aktuellen BGH-Entscheidung vom 25.03.2025 (VI ZR 174/24) hat der Senat betont, dass bei gewerblich mit dem Automarkt vertrauten Eigentümern (hier: Sicherungsnehmerin/Bank) die Messlatte höher liegen kann; fehlt dem Geschädigten (Kläger) hierzu Vortrag, kann der Versicherer mit einem höheren (internetbasierten) Angebot durchdringen. Ergebnis dort: Anrechnung eines höheren, internetbasierten Restwerts. Für private Geschädigte ohne besondere Marktkenntnis gilt diese Verschärfung regelmäßig nicht.
Gleichzeitig hat der BGH (zuletzt am 02.07.2024 – VI ZR 211/22 – und am 25.06.2019 – VI ZR 358/18) den Grundsatz bestätigt: Der private Geschädigte darf grundsätzlich auf die korrekt ermittelte regionale Dreier-Restwertbasis vertrauen, ohne überregional zu recherchieren oder die Versicherung abzuwarten. Das Risiko einer „besseren“ internetbasierten Verwertung trägt dann nicht er.
Aktuelle Rechtsprechung im Überblick – was Sie wissen sollten
BGH, Urteil vom 25.03.2025 – VI ZR 174/24: Wirtschaftlichkeitsgebot gilt auch für den Restwert; subjektbezogene Betrachtung bleibt maßgeblich. Private Geschädigte genügen dem Gebot regelmäßig durch Verkauf zum im Gutachten regional und konkret ermittelten Restwert (drei Angebote). In Konstellationen mit gewerblich versierten Eigentümern (z. B. Sicherungsnehmerin/Bank) kann ein höheres, internetbasiertes Angebot maßgeblich sein, wenn die strengeren Maßstäbe greifen und der Kläger hierzu nicht hinreichend vorträgt.
BGH, st. Rspr. – u. a. 02.07.2024 – VI ZR 211/22; 25.06.2019 – VI ZR 358/18; 27.09.2016 – VI ZR 673/15; 13.10.2009 – VI ZR 318/08: Der Geschädigte genügt regelmäßig, wenn er auf ein korrektes Gutachten mit drei regionalen Angeboten baut; keine Pflicht zur Internetrecherche oder zum Abwarten eines etwaigen Versichererangebots vor Veräußerung. .
OLG Hamm, Urteil vom 26.04.2023 – 11 U 66/22: Realisiert der Geschädigte das höchste der drei im Gutachten ermittelten regionalen Angebote, genügt er dem Wirtschaftlichkeitsgebot; ein später vorgelegtes überregionales Angebot ist unbeachtlich, wenn es weder regional noch rechtzeitig ist.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.03.2018 – 1 U 55/17: Internetbasierte Einzelgebote ersetzen nicht die Ermittlung des regionalen Marktes anhand von mindestens drei Angeboten; Ausreißer sind abzufangen.
Praxishinweise aus der Rechtsprechung: Der Geschädigte darf sogleich zum gutachterlich ermittelten Restwert verkaufen; bloße Ankündigungen der Versicherung, „bald“ ein höheres Angebot zu schicken, genügen nicht. Entscheidend sind konkrete, rechtzeitig übermittelte, annahmefähige Angebote; ansonsten bleibt der Weg frei für die sofortige Veräußerung zum höchsten regionalen Dreierangebot.
Praxisleitfaden: So gehen Sie Schritt für Schritt vor
Sofort Sachverständigen beauftragen
Ziel: Feststellung Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert.
Achten Sie darauf, dass der Gutachter drei regionale Restwertangebote einholt, die Anbieter konkret benennt (mit Kontaktdaten) und die Regionalität nachvollziehbar ist. Nur so können Sie rechtssicher verkaufen.
Höchstes der drei regionalen Restwertangebote zugrunde legen
Sobald das Gutachten vorliegt, dürfen Sie den Verkauf zu diesem Höchstrestwert realisieren. Das genügt dem Wirtschaftlichkeitsgebot, wenn das Gutachten die korrekte Wertermittlung erkennen lässt.
Schriftlich verkaufen
Halten Sie Kaufpreis, Datum, Käufer, Abholmodalität, Fahrzeugdaten und ggf. Zusagen (kostenlose Abholung) schriftlich fest. Diese Dokumentation erleichtert die Regulierung und wehrt spätere Einwände ab.
Abschleppunternehmen ansprechen
Wenn das Fahrzeug bereits dort steht: Fragen Sie nach einem Ankauf zum höchsten regionalen Restwert. Häufig sind Logistik/Abholung schon organisiert; manche Angebote enthalten sogar eine kostenlose Abholung – das kann teure Weitertransporte vermeiden und die Abwicklung beschleunigen.
Versicherung informieren – aber nicht ausbremsen lassen
Sie sind nicht verpflichtet, vor Verkauf auf (mögliche) Versichererangebote zu warten. Kommt vor Veräußerung ein konkretes, verbindliches, zumutbares Höchstangebot, prüfen Sie es ernsthaft – sonst dürfen Sie zum höchsten regionalen Dreierangebot verkaufen.
Belege sammeln
Gutachten, drei Angebote, Kaufvertrag, Abholbestätigung, Zahlungsnachweis, Abschlepp-/Standkosten: Lückenlose Unterlagen beugen Streit vor und stützen Ihre Position.
Typische Einwände der Versicherung – und wie die Rechtsprechung darauf reagiert
„Sie hätten auf unser besseres Angebot warten müssen.“
Antwort: Ohne konkretes, verbindliches, rechtzeitig übermitteltes Angebot trifft Sie grundsätzlich keine Wartepflicht; Sie dürfen sofort zum höchsten regionalen Restwert veräußern. Bloße Ankündigungen („wir prüfen“, „bald Angebot“) genügen nicht.„Der regionale Markt ist zu klein – Internetbörsen bringen mehr.“
Antwort: Der BGH verlangt grundsätzlich den regionalen Markt. Auf überregionale oder internetbasierte Sondermärkte müssen private Geschädigte ohne besondere Marktkenntnis nicht ausweichen. Anders nur in Sonderkonstellationen (Leasinggeber, Autohaus, Bank als Sicherungsnehmerin) mit spezifischer Marktnähe.„Das Gutachten nennt keine drei regionalen Angebote/ist unklar.“
Antwort: Ein ordnungsgemäßes Gutachten muss drei regionale Angebote konkret benennen. Fehlt das, kann das Vertrauen eingeschränkt sein; hier empfiehlt sich die Nachbesserung durch den Sachverständigen. Liegen die drei Angebote vor und sind regional, genügt der Verkauf zum höchsten Angebot.„Unser Angebot war höher und enthielt kostenlose Abholung – das hätten Sie annehmen müssen.“
Antwort: Nur wenn dieses Angebot rechtzeitig vor dem Verkauf und für Sie zumutbar sowie verbindlich war, kann eine Annahmepflicht bestehen. Andernfalls bleibt Ihr Verkauf zum höchsten regionalen Dreierangebot rechtmäßig. Beachten Sie: Die kostenlose Abholung zeigt, dass Logistik eine entscheidende Rolle spielt – sie kann die Zumutbarkeit erhöhen.
Häufige Fehler – und wie Sie sie vermeiden
Zu wenig oder falsche Angebote: Achten Sie darauf, dass der Gutachter drei regionale, konkrete Angebote dokumentiert. Fehlen Regionalität oder Konkretisierung, leidet die Beweiskraft – und die Versicherung hat Angriffsfläche. .
Warten auf „Ankündigungen“: Verzögern Sie nicht unnötig. Ohne rechtzeitig übermittelte, konkrete Angebote der Gegenseite dürfen Sie umgehend verkaufen.
Unklare Verkaufsdokumentation: Der Verkauf muss schriftlich belegt werden (Kaufvertrag/Ankaufsschein mit Datum, Preis, Daten). Das vermeidet spätere Beweisnöte.
Teure Folgekosten: Prüfen Sie mit dem Abschleppunternehmen die Möglichkeit der Übernahme/Ankaufs vor Ort zum höchsten regionalen Restwert, um Weitertransporte und Standkosten zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob das Angebot eine kostenlose Abholung enthält.
Kurz-Fallstudien aus jüngerer Rechtsprechung
OLG Hamm 2023 (11 U 66/22): Geschädigter realisiert das höchste von drei regionalen Restwertangeboten; kein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot, selbst wenn die Versicherung später ein überregionales, höheres Angebot benennt, das weder regional noch rechtzeitig war. Ergebnis: Anspruch zugesprochen.
OLG Düsseldorf 2018 (1 U 55/17): Vier Internetgebote ersetzen nicht den regionalen Markt; drei regionale Angebote sind erforderlich, um Ausreißer zu vermeiden. Ergebnis: Der Geschädigte durfte sich am regionalen Dreier-Set orientieren.
BGH 2025 (VI ZR 174/24): Bei einer Sicherungsnehmerin/Bank als (Mit-)Berechtigte stellte der BGH auf strengere Maßstäbe ab; mangels Darlegung des Klägers zur subjektbezogenen Betrachtung setzte sich ein höheres internetbasiertes Angebot durch. Merksatz: Private dürfen regional bleiben; professionelle Marktakteure müssen ggf. mehr.
FAQ: Ihre wichtigsten Fragen zur Restwertveräußerung nach Totalschaden
Muss ich vor dem Verkauf auf ein Angebot der Versicherung warten?
Nein – sofern Ihr Gutachten eine korrekte Restwertermittlung auf regionaler Dreierbasis enthält. Nur ein rechtzeitig übermitteltes, verbindliches und zumutbares Höchstangebot kann ausnahmsweise vorgehen.Darf ich das Fahrzeug an das Abschleppunternehmen verkaufen?
Ja, wenn das Abschleppunternehmen ein in das regionale Dreier-Set passendes, verbindliches (idealerweise höchstes) Angebot stellt. Das ist regelmäßig sinnvoll, da Logistik und Abholung oft bereits organisiert sind; manche Angebote beinhalten kostenlose Abholung.Was passiert, wenn die Versicherung später ein höheres Internetangebot präsentiert?
Ist der Verkauf bereits erfolgt, bleibt Ihr erzielter (korrekt ermittelter) Restwert maßgeblich. Nur vor dem Verkauf rechtzeitig vorgelegte, zumutbare Angebote sind relevant.Was, wenn mein Gutachten keine drei regionalen Angebote enthält?
Bitten Sie den Sachverständigen um Ergänzung/Nachbesserung. Der BGH fordert regelmäßig drei regionale Angebote; das sichert Ihre Position erheblich.Muss ich überregional oder im Internet nach höheren Angeboten suchen?
Regelmäßig nein – für private Geschädigte genügt der regionale Markt. Sonderfälle (z. B. Leasinggeber, Autohaus, Bank als Sicherungsnehmerin) können strengere Anforderungen begründen.
Checkliste für die Mandantschaft
Auftrag an Sachverständigen mit klarer Vorgabe: drei regionale Restwertangebote, Anbieter benennen, Höchstwert dokumentieren.
Verkauf zum höchsten der drei regionalen Angebote. Zügig.
Schriftlicher Kaufvertrag mit Datum, Preis, Käufer, Abholmodalitäten.
Abschleppunternehmen ansprechen: Ankauf/Übernahme vor Ort zum Höchstrestwert? Kostenlose Abholung? So lassen sich Transport- und Standkosten vermeiden.
Versicherer informieren – aber nicht blockieren lassen: Nur konkrete, verbindliche, zumutbare und rechtzeitig übermittelte Angebote sind zu beachten.
Lückenlos dokumentieren: Gutachten, Angebote, Kaufvertrag, Zahlungsbeleg, ggf. Logistik-/Abholzusagen.
Fazit

Aus der Praxis.
Aktuell informiert.
Mietrecht
2026
Einstweiliger Rechtsschutz zeigt Wirkung – Vermieterin entfernt eigenmächtig angebrachte Schlösser
Mit Beschluss vom 14.08.2025 (Az. 1 C 124/25) hat das Amtsgericht Philippsburg in einem von unserer Kanzlei geführten Verfahren die Kosten der Vermieterin auferlegt. Rechtsanwalt Gier vertrat die Verfügungskläger erfolgreich.
Hintergrund des Falls war, dass die Vermieterin Anfang August 2025 ohne Vorankündigung den direkten Zugang zu den im Keller gelegenen Gemeinschaftsräumen (Waschküche und Trockenplatz) versperrt hatte. Hierzu brachte sie Gittertüren mit Ketten und Vorhängeschlössern an. Die Mieter waren dadurch faktisch von der Nutzung ausgeschlossen – obwohl die Mitbenutzung dieser Räume seit Jahrzehnten vertraglich vereinbart war.
Unsere Kanzlei reagierte umgehend mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, um die sofortige Wiedereinräumung des Mitbesitzes durchzusetzen. Noch bevor das Gericht über den Antrag entscheiden musste, entfernte die Vermieterin nach Zustellung der Antragsschrift die Schlösser und gab den Zugang wieder frei.
Daraufhin erklärten wir den Rechtsstreit für erledigt. Die Gegenseite übernahm die Kosten des Verfahrens, was das Gericht mit Beschluss vom 14.08.2025 bestätigte.
Der Fall zeigt anschaulich: Vermieter dürfen den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache nicht eigenmächtig einschränken. Wer ohne Rechtsgrund verschließt oder den Zugang zu Gemeinschaftsräumen blockiert, setzt sich dem Vorwurf verbotener Eigenmacht aus und muss mit sofortigen gerichtlichen Schritten rechnen. Für Mieter bedeutet dies, dass sie nicht schutzlos gestellt sind – bereits ein schneller Antrag auf einstweilige Verfügung kann Vermieter dazu bewegen, ihr rechtswidriges Verhalten sofort zu beenden.
Fazit: Auch wenn es hier keiner inhaltlichen Entscheidung des Gerichts bedurfte, hat das Verfahren deutlich gemacht: Eigenmächtige Eingriffe durch Vermieter haben im Mietrecht keinen Platz. Mit entschlossenem Vorgehen lassen sich Mieterrechte wirksam und zeitnah sichern.
Praxis-Tipp für Mieter: Wenn Vermieter plötzlich den Zugang zu mitvermieteten Räumen oder Gemeinschaftsflächen versperren, sollten betroffene Mieter schnell reagieren. Wichtig ist, die Situation unmittelbar zu dokumentieren – etwa durch Fotos oder Zeugen – und den Vermieter nachweisbar zur sofortigen Beseitigung der Sperre aufzufordern. Erfolgt keine Abhilfe, kann eine einstweilige Verfügung beantragt werden, mit der sich der rechtmäßige Besitz kurzfristig sichern lässt. Schnelles Handeln ist entscheidend, um die eigenen Rechte effektiv zu wahren.
Mietrecht
2026
Wenn Nachbarn zu weit gehen
Gericht stärkt Persönlichkeitsrechte gegen unerwünschte Videoüberwachung
Das Thema Überwachung durch privat installierte Kameras sorgt regelmäßig für Streit unter Nachbarn. In einem aktuellen Verfahren, das von Rechtsanwalt Gier betreut wurde, ist nun ein wegweisendes Urteil ergangen. Das Amtsgericht Bruchsal hat am 14.10.2025 (Az. 4 C 106/23) unsere Mandanten in ihrem Recht auf Schutz der Privatsphäre gestärkt und die unerwünschte Videoüberwachung durch den Nachbarn untersagt.
Im zugrunde liegenden Fall lebten unsere Mandanten in einer Reihenhausanlage, gemeinsam mit dem beklagten Nachbarn, der an seinem Haus mehrere Überwachungskameras angebracht hatte. Zwischen den Parteien bestand bereits eine länger schwelende Nachbarschaftsstreitigkeit, die sich unter anderem um die Nutzung und Gestaltung der Grundstücke drehte. Die Installation der Kameras führte zu erheblicher Verunsicherung bei unseren Mandanten, da technisch die Möglichkeit bestand, dass deren Grundstück und Garten überwacht wurden. Obwohl der Nachbar behauptete, seine Kameras würden ausschließlich sein eigenes Grundstück filmen, konnte durch ein Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen nachgewiesen werden, dass die Kameras tatsächlich so ausgerichtet werden konnten (und teils auch waren), dass sie Bereiche unserer Mandanten erfassten. Besonders problematisch war die Möglichkeit, dass die Kameras per App unbemerkt aus der Ferne gesteuert werden konnten. Der rechtliche Streit drehte sich zentral um die Frage, inwieweit Eigentümer von Nachbargrundstücken solcher Überwachung und sogar dem damit verbundenen Überwachungsdruck ausgesetzt sein müssen.
Das Gericht hat ausgesprochen deutlich gemacht, dass bereits der objektiv begründete Eindruck einer potentiellen Überwachung – der sogenannte Überwachungsdruck – eine unzumutbare Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darstellt, selbst wenn gar keine dauerhafte oder aktuelle Aufzeichnung erfolgt. Maßgeblich ist dabei, ob Betroffene ernsthaft befürchten müssen, gefilmt zu werden. Insofern hat das Gericht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestätigt und weiter konkretisiert: Es kommt nicht darauf an, wie der Kamerawinkel in einem bestimmten Moment eingestellt ist; entscheidend ist vielmehr, welche technische Möglichkeit und damit verbundene Unsicherheit besteht. So genügt es, dass eine Kamera unbemerkt auf das Nachbargrundstück gerichtet werden kann, um einen Unterlassungsanspruch zu begründen. Das Gericht betonte zudem, dass das Interesse am Schutz des Eigentums durch Kameras das Persönlichkeitsrecht Dritter allenfalls dann überwiegt, wenn ausschließlich das eigene Grundstück erfasst wird. Sobald aber – wie im vorliegenden Fall – die Möglichkeit der Überwachung fremder Grundstücksteile besteht, ist die Installation und der Betrieb solcher Kameras unzulässig. Folge dieses Urteils war nicht nur die Verpflichtung zur Entfernung der Kameras, sondern auch die Androhung erheblichen Ordnungsgelds für den Fall erneuter Zuwiderhandlung.
Für die Praxis bedeutet dieses Urteil eine klare Stärkung der Rechte von Hauseigentümern und Mietern, die sich gegen die Überwachung durch Nachbarn zur Wehr setzen möchten. Es genügt nicht, dass der Kamerabetreiber versichert, niemanden überwachen zu wollen: Allein die Möglichkeit der Ausrichtung auf fremde Bereiche reicht schon aus, um einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht zu begründen – insbesondere bei angespannten Nachbarschaftsverhältnissen. Personen, die sich durch eine Kamera ihres Nachbarn beeinträchtigt fühlen, sollten daher nicht zögern, ihren Unterlassungsanspruch geltend zu machen. Umgekehrt ist Eigentümern, die ihr Grundstück mit Kameras schützen wollen, dringend anzuraten, die technische Ausrichtung und Reichweite so zu wählen, dass keinerlei Zweifel an einer ausschließlichen Überwachung des eigenen Grundstücks bestehen.
Das Urteil unterstreicht, wie wichtig sorgsame anwaltliche Begleitung bei Nachbarschaftskonflikten ist. Für unsere Mandanten war es maßgeblich, dass mithilfe eines Sachverständigengutachtens und gezielter Beweiserhebung die tatsächliche Gefahr (und der Eindruck) einer Überwachung belegt werden konnte. Unsere Kanzlei hat mit diesem Verfahren nicht nur zum Schutz der Privatsphäre unserer Mandanten beigetragen, sondern auch dazu, dass rechtliche Klarheit und Sicherheit für vergleichbare Fälle geschaffen wurde. Wir beraten Sie gerne, sollten Sie Fragen zu solchen Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dem Einsatz privater Videoüberwachung haben.
Verkehrsrecht
2025
Totalschaden – und jetzt? Warum Sie Ihr Unfallfahrzeug schnell und klug veräußern sollten
Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist belastend – aber er eröffnet auch klare Handlungsmöglichkeiten. Wer zügig und richtig vorgeht, vermeidet Streit mit der gegnerischen Versicherung, reduziert Folgekosten (z. B. Stand- und Transportkosten) und beschleunigt die Auszahlung. Entscheidend ist: Lassen Sie ein belastbares Gutachten erstellen, in dem der Sachverständige drei konkrete Restwertangebote vom allgemeinen regionalen Markt einholt – und verwenden Sie für die Veräußerung den höchsten dieser drei Werte. Dokumentieren Sie den Verkauf schriftlich. Wurde Ihr Fahrzeug abgeschleppt, fragen Sie das Abschleppunternehmen, ob ein Ankauf zum höchsten regionalen Restwert möglich ist; so können Sie teure Weitertransporte vermeiden und die Abwicklung spürbar vereinfachen. Diese Vorgehensweise entspricht der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Wirtschaftlichkeitsgebot und zur subjektbezogenen Schadensbetrachtung.
Die drei Grundpfeiler: Wirtschaftlichkeitsgebot, regionaler Markt, drei Restwertangebote
Wirtschaftlichkeitsgebot: Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB muss der Geschädigte den wirtschaftlich vernünftigen Weg der Schadensbehebung wählen. Das gilt ausdrücklich auch für die Verwertung des Unfallfahrzeugs (Restwert). Der Bundesgerichtshof (BGH) betont, dass die Schadensersatzpflicht „von vornherein nur insoweit“ besteht, als sich die Verwertung im Rahmen wirtschaftlicher Vernunft hält. Zugleich erfolgt die Bewertung subjektbezogen: Es kommt auf Ihre Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten in Ihrer konkreten Lage an.
Allgemeiner regionaler Markt: Der Geschädigte leistet dem Wirtschaftlichkeitsgebot im Regelfall Genüge, wenn er sein Fahrzeug zu dem Preis veräußert, den ein von ihm beauftragter Sachverständiger als Restwert auf dem allgemeinen regionalen Markt ermittelt hat. Eigene Marktforschung überregional oder in Internet-Restwertbörsen schulden Sie grundsätzlich nicht.
Drei konkrete Angebote: Der Sachverständige hat als belastbare Schätzgrundlage regelmäßig drei Restwertangebote einzuholen und im Gutachten konkret zu benennen. Diese Dreizahl entspricht der Empfehlung des 40. Deutschen Verkehrsgerichtstages und ist vom BGH mehrfach bestätigt worden.
Diese drei Eckpfeiler sind in jüngster Zeit erneut vom BGH bekräftigt worden. In der Entscheidung vom 25.03.2025 (VI ZR 174/24) hebt der BGH hervor, dass die Restwertfrage Teil des Wirtschaftlichkeitsgebots ist und die individuelle Situation des Geschädigten zu berücksichtigen bleibt; zugleich genügt der Geschädigte regelmäßig, wenn er auf ein ordnungsgemäßes Gutachten mit konkreter regionaler Restwertermittlung baut.
Schnell handeln – aber richtig: Warum Tempo bei der Veräußerung hilft
Je schneller nach Gutachtenerstellung veräußert wird, desto eher vermeiden Sie Streitpunkte wie Standkosten, Verzögerungen und sich ändernde Marktpreise. Die Rechtsprechung stellt klar, dass Sie grundsätzlich nicht warten müssen, bis die gegnerische Versicherung „vielleicht“ ein höheres Restwertangebot übersendet. Solange ein korrektes, regionales Dreierangebot im Gutachten vorliegt, sind Sie berechtigt, sofort zum gutachterlich ermittelten (höchsten) Restwert zu verkaufen.
Der BGH hat wiederholt betont, dass der Geschädigte nicht verpflichtet ist, den Versicherer vorab um Stellungnahme zu bitten oder überregional/internetbasiert „bessere“ Angebote abzuwarten; die Abwicklung in eigener Regie ist gesetzlich gewollt. Dies wurde u. a. in den Entscheidungen VI ZR 358/18 (2019) und VI ZR 211/22 (2024) betont.
Ein praktisches Gegenbeispiel, wann ausnahmsweise ein Zuwarten geboten sein kann, ist selten – und dann nur, wenn die Versicherung vor dem Verkauf ein konkretes, zumutbares, verbindliches und oft sogar mit kostenloser Abholung verbundenes Höchstangebot vorlegt. Liegt ein solches annahmefähiges, höheres Angebot rechtzeitig vor, kann regelmäßig die Pflicht bestehen, es aus Schadensminderungsgründen zu berücksichtigen. Fehlt es daran, dürfen Sie verkaufen.
Der „Dreiklang“ im Gutachten: Drei regionale Restwertangebote – höchstes Angebot wählen
Warum drei? Die Dreizahl verhindert Zufallsergebnisse („Ausreißer“) und bildet den regionalen Markt zuverlässig ab. Deshalb verlangt der BGH, dass der Sachverständige regelmäßig drei konkrete regionale Angebote einholt und die Anbieter nennt.
Regionalität: Angebote müssen dem für Sie ohne weiteres zugänglichen regionalen Markt entstammen; internetbasierte Spezialbörsen sind regelmäßig kein Muss. Treffen die drei Angebote diese regionalen Anforderungen, genügt es, den höchsten dieser drei Werte als Restwert zugrunde zu legen.
Schriftliche Dokumentation: Halten Sie Angebot, Annahme und Kaufvertrag schriftlich fest (Kaufvertrag mit Datum, Anbieter, Betrag, etwaiger Abholungszusagen). Diese Dokumentation sichert den Nachweis der ordnungsgemäßen, wirtschaftlich vernünftigen Verwertung.
Auch Obergerichte folgen diesem Dreiklang: So hat das OLG Hamm bestätigt, dass der Geschädigte dem Wirtschaftlichkeitspostulat genügt, wenn er eines der drei im Gutachten genannten Restwertangebote – und zwar das höchste – realisiert. Maßgeblich ist der regionale Markt; auf internetbasierte Spezialbörsen kann der Geschädigte regelmäßig nicht verwiesen werden.
Abschleppunternehmen einbinden: Transportkosten vermeiden, Abwicklung erleichtern
Ist Ihr Fahrzeug abgeschleppt worden, lohnt stets die Nachfrage beim Abschleppunternehmen, ob ein Ankauf zum höchsten regionalen Restwert möglich ist. Das ist oft pragmatisch: Es erspart weitergehende Transport- und Standkosten, die sonst die Regulierung belasten können, und beschleunigt die Abwicklung vor Ort. Zudem enthalten manche Restwertangebote – auch aus der Versicherersphäre – ausdrücklich die Zusage einer kostenfreien Abholung; das zeigt, wie bedeutsam Logistik- und Transportkosten in der Restwertpraxis sind. Prüfen Sie daher stets, ob das Abschleppunternehmen die Abholung/Übernahme vor Ort mit abdeckt.
Wichtig: Bleiben Sie beim regionalen Markt. Wenn das Abschleppunternehmen als regionaler Anbieter auftritt und ein in das Dreier-Set passendes, verbindliches Höchstangebot stellt, kann der Verkauf dorthin besonders wirtschaftlich und komfortabel sein. Das beschleunigt die Auszahlung, vermeidet Doppel- oder Weitertransportkosten und hält Sie zugleich auf der sicheren Seite der Rechtsprechung.
Schriftlich verkaufen – warum die Form wichtig ist
Der Verkauf sollte stets schriftlich erfolgen: Es belegt Preis, Datum, Käuferdaten, Abholungsmodalitäten und ggf. die Anrechnung des Restwerts. Diese Klarheit hilft bei der anschließenden Regulierung, insbesondere wenn die Versicherung Fragen zur Höhe des Restwerts stellt oder behauptet, es habe ein höheres (später vorgelegtes) Angebot gegeben. Auch bei einem späteren Streit über den Zugang von Versichererangeboten zeigt eine lückenlose Dokumentation, dass Sie zügig und wirtschaftlich gehandelt haben.
Was gilt, wenn die Versicherung ein höheres Angebot schickt?
Vor dem Verkauf: Erhalten Sie vor der Veräußerung ein konkretes, zumutbares, verbindliches Höchstangebot (typischerweise mit kostenfreier Abholung, klarer Preisangabe und Ansprechpartner), kann ausnahmsweise eine Pflicht bestehen, dieses Angebot anzunehmen (Schadensminderungspflicht). Fehlt es an Verbindlichkeit, Zumutbarkeit oder rechtzeitiger Übermittlung, dürfen Sie zum höchsten regionalen Dreierangebot verkaufen.
Nach dem Verkauf: Haben Sie bereits veräußert, ist der erzielte Restwert maßgeblich. Ein nachträglich übersandtes „höheres“ Angebot bleibt regelmäßig unbeachtlich. Das Risiko, dass nach der Veräußerung andere (später) mehr geboten hätten, trägt grundsätzlich nicht der Geschädigte.
Nur regional und konkret zählt: Mehrfach hat die Rechtsprechung Internet-Höchstgebote verworfen, wenn sie nicht dem regionalen Markt entsprachen. Der BGH verlangt, dass die Restwertermittlung regional erfolgt und der Geschädigte nicht auf einen Sondermarkt im Internet verwiesen wird – es sei denn, besondere Konstellationen (z. B. professionelle Marktteilnehmer) rechtfertigen ausnahmsweise mehr.
Sonderfälle: Leasing, Sicherungsübereignung, gewerbliche Marktkenntnis
Die Rechtsprechung bleibt subjektbezogen: In besonderen Konstellationen – z. B. bei Leasinggeberinnen, Autohaus-Geschädigten oder Sicherungsnehmerinnen (Banken) – können strengere Anforderungen an die Restwertrecherche gelten, insbesondere wenn diese Akteure typischerweise über erweiterte Marktkenntnisse verfügen und ihnen die Nutzung überregionaler oder internetbasierter Restwertbörsen zumutbar ist. In der aktuellen BGH-Entscheidung vom 25.03.2025 (VI ZR 174/24) hat der Senat betont, dass bei gewerblich mit dem Automarkt vertrauten Eigentümern (hier: Sicherungsnehmerin/Bank) die Messlatte höher liegen kann; fehlt dem Geschädigten (Kläger) hierzu Vortrag, kann der Versicherer mit einem höheren (internetbasierten) Angebot durchdringen. Ergebnis dort: Anrechnung eines höheren, internetbasierten Restwerts. Für private Geschädigte ohne besondere Marktkenntnis gilt diese Verschärfung regelmäßig nicht.
Gleichzeitig hat der BGH (zuletzt am 02.07.2024 – VI ZR 211/22 – und am 25.06.2019 – VI ZR 358/18) den Grundsatz bestätigt: Der private Geschädigte darf grundsätzlich auf die korrekt ermittelte regionale Dreier-Restwertbasis vertrauen, ohne überregional zu recherchieren oder die Versicherung abzuwarten. Das Risiko einer „besseren“ internetbasierten Verwertung trägt dann nicht er.
Aktuelle Rechtsprechung im Überblick – was Sie wissen sollten
BGH, Urteil vom 25.03.2025 – VI ZR 174/24: Wirtschaftlichkeitsgebot gilt auch für den Restwert; subjektbezogene Betrachtung bleibt maßgeblich. Private Geschädigte genügen dem Gebot regelmäßig durch Verkauf zum im Gutachten regional und konkret ermittelten Restwert (drei Angebote). In Konstellationen mit gewerblich versierten Eigentümern (z. B. Sicherungsnehmerin/Bank) kann ein höheres, internetbasiertes Angebot maßgeblich sein, wenn die strengeren Maßstäbe greifen und der Kläger hierzu nicht hinreichend vorträgt.
BGH, st. Rspr. – u. a. 02.07.2024 – VI ZR 211/22; 25.06.2019 – VI ZR 358/18; 27.09.2016 – VI ZR 673/15; 13.10.2009 – VI ZR 318/08: Der Geschädigte genügt regelmäßig, wenn er auf ein korrektes Gutachten mit drei regionalen Angeboten baut; keine Pflicht zur Internetrecherche oder zum Abwarten eines etwaigen Versichererangebots vor Veräußerung. .
OLG Hamm, Urteil vom 26.04.2023 – 11 U 66/22: Realisiert der Geschädigte das höchste der drei im Gutachten ermittelten regionalen Angebote, genügt er dem Wirtschaftlichkeitsgebot; ein später vorgelegtes überregionales Angebot ist unbeachtlich, wenn es weder regional noch rechtzeitig ist.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.03.2018 – 1 U 55/17: Internetbasierte Einzelgebote ersetzen nicht die Ermittlung des regionalen Marktes anhand von mindestens drei Angeboten; Ausreißer sind abzufangen.
Praxishinweise aus der Rechtsprechung: Der Geschädigte darf sogleich zum gutachterlich ermittelten Restwert verkaufen; bloße Ankündigungen der Versicherung, „bald“ ein höheres Angebot zu schicken, genügen nicht. Entscheidend sind konkrete, rechtzeitig übermittelte, annahmefähige Angebote; ansonsten bleibt der Weg frei für die sofortige Veräußerung zum höchsten regionalen Dreierangebot.
Praxisleitfaden: So gehen Sie Schritt für Schritt vor
Sofort Sachverständigen beauftragen
Ziel: Feststellung Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert.
Achten Sie darauf, dass der Gutachter drei regionale Restwertangebote einholt, die Anbieter konkret benennt (mit Kontaktdaten) und die Regionalität nachvollziehbar ist. Nur so können Sie rechtssicher verkaufen.
Höchstes der drei regionalen Restwertangebote zugrunde legen
Sobald das Gutachten vorliegt, dürfen Sie den Verkauf zu diesem Höchstrestwert realisieren. Das genügt dem Wirtschaftlichkeitsgebot, wenn das Gutachten die korrekte Wertermittlung erkennen lässt.
Schriftlich verkaufen
Halten Sie Kaufpreis, Datum, Käufer, Abholmodalität, Fahrzeugdaten und ggf. Zusagen (kostenlose Abholung) schriftlich fest. Diese Dokumentation erleichtert die Regulierung und wehrt spätere Einwände ab.
Abschleppunternehmen ansprechen
Wenn das Fahrzeug bereits dort steht: Fragen Sie nach einem Ankauf zum höchsten regionalen Restwert. Häufig sind Logistik/Abholung schon organisiert; manche Angebote enthalten sogar eine kostenlose Abholung – das kann teure Weitertransporte vermeiden und die Abwicklung beschleunigen.
Versicherung informieren – aber nicht ausbremsen lassen
Sie sind nicht verpflichtet, vor Verkauf auf (mögliche) Versichererangebote zu warten. Kommt vor Veräußerung ein konkretes, verbindliches, zumutbares Höchstangebot, prüfen Sie es ernsthaft – sonst dürfen Sie zum höchsten regionalen Dreierangebot verkaufen.
Belege sammeln
Gutachten, drei Angebote, Kaufvertrag, Abholbestätigung, Zahlungsnachweis, Abschlepp-/Standkosten: Lückenlose Unterlagen beugen Streit vor und stützen Ihre Position.
Typische Einwände der Versicherung – und wie die Rechtsprechung darauf reagiert
„Sie hätten auf unser besseres Angebot warten müssen.“
Antwort: Ohne konkretes, verbindliches, rechtzeitig übermitteltes Angebot trifft Sie grundsätzlich keine Wartepflicht; Sie dürfen sofort zum höchsten regionalen Restwert veräußern. Bloße Ankündigungen („wir prüfen“, „bald Angebot“) genügen nicht.„Der regionale Markt ist zu klein – Internetbörsen bringen mehr.“
Antwort: Der BGH verlangt grundsätzlich den regionalen Markt. Auf überregionale oder internetbasierte Sondermärkte müssen private Geschädigte ohne besondere Marktkenntnis nicht ausweichen. Anders nur in Sonderkonstellationen (Leasinggeber, Autohaus, Bank als Sicherungsnehmerin) mit spezifischer Marktnähe.„Das Gutachten nennt keine drei regionalen Angebote/ist unklar.“
Antwort: Ein ordnungsgemäßes Gutachten muss drei regionale Angebote konkret benennen. Fehlt das, kann das Vertrauen eingeschränkt sein; hier empfiehlt sich die Nachbesserung durch den Sachverständigen. Liegen die drei Angebote vor und sind regional, genügt der Verkauf zum höchsten Angebot.„Unser Angebot war höher und enthielt kostenlose Abholung – das hätten Sie annehmen müssen.“
Antwort: Nur wenn dieses Angebot rechtzeitig vor dem Verkauf und für Sie zumutbar sowie verbindlich war, kann eine Annahmepflicht bestehen. Andernfalls bleibt Ihr Verkauf zum höchsten regionalen Dreierangebot rechtmäßig. Beachten Sie: Die kostenlose Abholung zeigt, dass Logistik eine entscheidende Rolle spielt – sie kann die Zumutbarkeit erhöhen.
Häufige Fehler – und wie Sie sie vermeiden
Zu wenig oder falsche Angebote: Achten Sie darauf, dass der Gutachter drei regionale, konkrete Angebote dokumentiert. Fehlen Regionalität oder Konkretisierung, leidet die Beweiskraft – und die Versicherung hat Angriffsfläche. .
Warten auf „Ankündigungen“: Verzögern Sie nicht unnötig. Ohne rechtzeitig übermittelte, konkrete Angebote der Gegenseite dürfen Sie umgehend verkaufen.
Unklare Verkaufsdokumentation: Der Verkauf muss schriftlich belegt werden (Kaufvertrag/Ankaufsschein mit Datum, Preis, Daten). Das vermeidet spätere Beweisnöte.
Teure Folgekosten: Prüfen Sie mit dem Abschleppunternehmen die Möglichkeit der Übernahme/Ankaufs vor Ort zum höchsten regionalen Restwert, um Weitertransporte und Standkosten zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob das Angebot eine kostenlose Abholung enthält.
Kurz-Fallstudien aus jüngerer Rechtsprechung
OLG Hamm 2023 (11 U 66/22): Geschädigter realisiert das höchste von drei regionalen Restwertangeboten; kein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot, selbst wenn die Versicherung später ein überregionales, höheres Angebot benennt, das weder regional noch rechtzeitig war. Ergebnis: Anspruch zugesprochen.
OLG Düsseldorf 2018 (1 U 55/17): Vier Internetgebote ersetzen nicht den regionalen Markt; drei regionale Angebote sind erforderlich, um Ausreißer zu vermeiden. Ergebnis: Der Geschädigte durfte sich am regionalen Dreier-Set orientieren.
BGH 2025 (VI ZR 174/24): Bei einer Sicherungsnehmerin/Bank als (Mit-)Berechtigte stellte der BGH auf strengere Maßstäbe ab; mangels Darlegung des Klägers zur subjektbezogenen Betrachtung setzte sich ein höheres internetbasiertes Angebot durch. Merksatz: Private dürfen regional bleiben; professionelle Marktakteure müssen ggf. mehr.
FAQ: Ihre wichtigsten Fragen zur Restwertveräußerung nach Totalschaden
Muss ich vor dem Verkauf auf ein Angebot der Versicherung warten?
Nein – sofern Ihr Gutachten eine korrekte Restwertermittlung auf regionaler Dreierbasis enthält. Nur ein rechtzeitig übermitteltes, verbindliches und zumutbares Höchstangebot kann ausnahmsweise vorgehen.Darf ich das Fahrzeug an das Abschleppunternehmen verkaufen?
Ja, wenn das Abschleppunternehmen ein in das regionale Dreier-Set passendes, verbindliches (idealerweise höchstes) Angebot stellt. Das ist regelmäßig sinnvoll, da Logistik und Abholung oft bereits organisiert sind; manche Angebote beinhalten kostenlose Abholung.Was passiert, wenn die Versicherung später ein höheres Internetangebot präsentiert?
Ist der Verkauf bereits erfolgt, bleibt Ihr erzielter (korrekt ermittelter) Restwert maßgeblich. Nur vor dem Verkauf rechtzeitig vorgelegte, zumutbare Angebote sind relevant.Was, wenn mein Gutachten keine drei regionalen Angebote enthält?
Bitten Sie den Sachverständigen um Ergänzung/Nachbesserung. Der BGH fordert regelmäßig drei regionale Angebote; das sichert Ihre Position erheblich.Muss ich überregional oder im Internet nach höheren Angeboten suchen?
Regelmäßig nein – für private Geschädigte genügt der regionale Markt. Sonderfälle (z. B. Leasinggeber, Autohaus, Bank als Sicherungsnehmerin) können strengere Anforderungen begründen.
Checkliste für die Mandantschaft
Auftrag an Sachverständigen mit klarer Vorgabe: drei regionale Restwertangebote, Anbieter benennen, Höchstwert dokumentieren.
Verkauf zum höchsten der drei regionalen Angebote. Zügig.
Schriftlicher Kaufvertrag mit Datum, Preis, Käufer, Abholmodalitäten.
Abschleppunternehmen ansprechen: Ankauf/Übernahme vor Ort zum Höchstrestwert? Kostenlose Abholung? So lassen sich Transport- und Standkosten vermeiden.
Versicherer informieren – aber nicht blockieren lassen: Nur konkrete, verbindliche, zumutbare und rechtzeitig übermittelte Angebote sind zu beachten.
Lückenlos dokumentieren: Gutachten, Angebote, Kaufvertrag, Zahlungsbeleg, ggf. Logistik-/Abholzusagen.
Fazit

Aus der Praxis.
Aktuell informiert.
Mietrecht
2026
Einstweiliger Rechtsschutz zeigt Wirkung – Vermieterin entfernt eigenmächtig angebrachte Schlösser
Mit Beschluss vom 14.08.2025 (Az. 1 C 124/25) hat das Amtsgericht Philippsburg in einem von unserer Kanzlei geführten Verfahren die Kosten der Vermieterin auferlegt. Rechtsanwalt Gier vertrat die Verfügungskläger erfolgreich.
Hintergrund des Falls war, dass die Vermieterin Anfang August 2025 ohne Vorankündigung den direkten Zugang zu den im Keller gelegenen Gemeinschaftsräumen (Waschküche und Trockenplatz) versperrt hatte. Hierzu brachte sie Gittertüren mit Ketten und Vorhängeschlössern an. Die Mieter waren dadurch faktisch von der Nutzung ausgeschlossen – obwohl die Mitbenutzung dieser Räume seit Jahrzehnten vertraglich vereinbart war.
Unsere Kanzlei reagierte umgehend mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, um die sofortige Wiedereinräumung des Mitbesitzes durchzusetzen. Noch bevor das Gericht über den Antrag entscheiden musste, entfernte die Vermieterin nach Zustellung der Antragsschrift die Schlösser und gab den Zugang wieder frei.
Daraufhin erklärten wir den Rechtsstreit für erledigt. Die Gegenseite übernahm die Kosten des Verfahrens, was das Gericht mit Beschluss vom 14.08.2025 bestätigte.
Der Fall zeigt anschaulich: Vermieter dürfen den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache nicht eigenmächtig einschränken. Wer ohne Rechtsgrund verschließt oder den Zugang zu Gemeinschaftsräumen blockiert, setzt sich dem Vorwurf verbotener Eigenmacht aus und muss mit sofortigen gerichtlichen Schritten rechnen. Für Mieter bedeutet dies, dass sie nicht schutzlos gestellt sind – bereits ein schneller Antrag auf einstweilige Verfügung kann Vermieter dazu bewegen, ihr rechtswidriges Verhalten sofort zu beenden.
Fazit: Auch wenn es hier keiner inhaltlichen Entscheidung des Gerichts bedurfte, hat das Verfahren deutlich gemacht: Eigenmächtige Eingriffe durch Vermieter haben im Mietrecht keinen Platz. Mit entschlossenem Vorgehen lassen sich Mieterrechte wirksam und zeitnah sichern.
Praxis-Tipp für Mieter: Wenn Vermieter plötzlich den Zugang zu mitvermieteten Räumen oder Gemeinschaftsflächen versperren, sollten betroffene Mieter schnell reagieren. Wichtig ist, die Situation unmittelbar zu dokumentieren – etwa durch Fotos oder Zeugen – und den Vermieter nachweisbar zur sofortigen Beseitigung der Sperre aufzufordern. Erfolgt keine Abhilfe, kann eine einstweilige Verfügung beantragt werden, mit der sich der rechtmäßige Besitz kurzfristig sichern lässt. Schnelles Handeln ist entscheidend, um die eigenen Rechte effektiv zu wahren.
Mietrecht
2026
Wenn Nachbarn zu weit gehen
Gericht stärkt Persönlichkeitsrechte gegen unerwünschte Videoüberwachung
Das Thema Überwachung durch privat installierte Kameras sorgt regelmäßig für Streit unter Nachbarn. In einem aktuellen Verfahren, das von Rechtsanwalt Gier betreut wurde, ist nun ein wegweisendes Urteil ergangen. Das Amtsgericht Bruchsal hat am 14.10.2025 (Az. 4 C 106/23) unsere Mandanten in ihrem Recht auf Schutz der Privatsphäre gestärkt und die unerwünschte Videoüberwachung durch den Nachbarn untersagt.
Im zugrunde liegenden Fall lebten unsere Mandanten in einer Reihenhausanlage, gemeinsam mit dem beklagten Nachbarn, der an seinem Haus mehrere Überwachungskameras angebracht hatte. Zwischen den Parteien bestand bereits eine länger schwelende Nachbarschaftsstreitigkeit, die sich unter anderem um die Nutzung und Gestaltung der Grundstücke drehte. Die Installation der Kameras führte zu erheblicher Verunsicherung bei unseren Mandanten, da technisch die Möglichkeit bestand, dass deren Grundstück und Garten überwacht wurden. Obwohl der Nachbar behauptete, seine Kameras würden ausschließlich sein eigenes Grundstück filmen, konnte durch ein Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen nachgewiesen werden, dass die Kameras tatsächlich so ausgerichtet werden konnten (und teils auch waren), dass sie Bereiche unserer Mandanten erfassten. Besonders problematisch war die Möglichkeit, dass die Kameras per App unbemerkt aus der Ferne gesteuert werden konnten. Der rechtliche Streit drehte sich zentral um die Frage, inwieweit Eigentümer von Nachbargrundstücken solcher Überwachung und sogar dem damit verbundenen Überwachungsdruck ausgesetzt sein müssen.
Das Gericht hat ausgesprochen deutlich gemacht, dass bereits der objektiv begründete Eindruck einer potentiellen Überwachung – der sogenannte Überwachungsdruck – eine unzumutbare Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darstellt, selbst wenn gar keine dauerhafte oder aktuelle Aufzeichnung erfolgt. Maßgeblich ist dabei, ob Betroffene ernsthaft befürchten müssen, gefilmt zu werden. Insofern hat das Gericht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestätigt und weiter konkretisiert: Es kommt nicht darauf an, wie der Kamerawinkel in einem bestimmten Moment eingestellt ist; entscheidend ist vielmehr, welche technische Möglichkeit und damit verbundene Unsicherheit besteht. So genügt es, dass eine Kamera unbemerkt auf das Nachbargrundstück gerichtet werden kann, um einen Unterlassungsanspruch zu begründen. Das Gericht betonte zudem, dass das Interesse am Schutz des Eigentums durch Kameras das Persönlichkeitsrecht Dritter allenfalls dann überwiegt, wenn ausschließlich das eigene Grundstück erfasst wird. Sobald aber – wie im vorliegenden Fall – die Möglichkeit der Überwachung fremder Grundstücksteile besteht, ist die Installation und der Betrieb solcher Kameras unzulässig. Folge dieses Urteils war nicht nur die Verpflichtung zur Entfernung der Kameras, sondern auch die Androhung erheblichen Ordnungsgelds für den Fall erneuter Zuwiderhandlung.
Für die Praxis bedeutet dieses Urteil eine klare Stärkung der Rechte von Hauseigentümern und Mietern, die sich gegen die Überwachung durch Nachbarn zur Wehr setzen möchten. Es genügt nicht, dass der Kamerabetreiber versichert, niemanden überwachen zu wollen: Allein die Möglichkeit der Ausrichtung auf fremde Bereiche reicht schon aus, um einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht zu begründen – insbesondere bei angespannten Nachbarschaftsverhältnissen. Personen, die sich durch eine Kamera ihres Nachbarn beeinträchtigt fühlen, sollten daher nicht zögern, ihren Unterlassungsanspruch geltend zu machen. Umgekehrt ist Eigentümern, die ihr Grundstück mit Kameras schützen wollen, dringend anzuraten, die technische Ausrichtung und Reichweite so zu wählen, dass keinerlei Zweifel an einer ausschließlichen Überwachung des eigenen Grundstücks bestehen.
Das Urteil unterstreicht, wie wichtig sorgsame anwaltliche Begleitung bei Nachbarschaftskonflikten ist. Für unsere Mandanten war es maßgeblich, dass mithilfe eines Sachverständigengutachtens und gezielter Beweiserhebung die tatsächliche Gefahr (und der Eindruck) einer Überwachung belegt werden konnte. Unsere Kanzlei hat mit diesem Verfahren nicht nur zum Schutz der Privatsphäre unserer Mandanten beigetragen, sondern auch dazu, dass rechtliche Klarheit und Sicherheit für vergleichbare Fälle geschaffen wurde. Wir beraten Sie gerne, sollten Sie Fragen zu solchen Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dem Einsatz privater Videoüberwachung haben.
Verkehrsrecht
2025
Totalschaden – und jetzt? Warum Sie Ihr Unfallfahrzeug schnell und klug veräußern sollten
Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist belastend – aber er eröffnet auch klare Handlungsmöglichkeiten. Wer zügig und richtig vorgeht, vermeidet Streit mit der gegnerischen Versicherung, reduziert Folgekosten (z. B. Stand- und Transportkosten) und beschleunigt die Auszahlung. Entscheidend ist: Lassen Sie ein belastbares Gutachten erstellen, in dem der Sachverständige drei konkrete Restwertangebote vom allgemeinen regionalen Markt einholt – und verwenden Sie für die Veräußerung den höchsten dieser drei Werte. Dokumentieren Sie den Verkauf schriftlich. Wurde Ihr Fahrzeug abgeschleppt, fragen Sie das Abschleppunternehmen, ob ein Ankauf zum höchsten regionalen Restwert möglich ist; so können Sie teure Weitertransporte vermeiden und die Abwicklung spürbar vereinfachen. Diese Vorgehensweise entspricht der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Wirtschaftlichkeitsgebot und zur subjektbezogenen Schadensbetrachtung.
Die drei Grundpfeiler: Wirtschaftlichkeitsgebot, regionaler Markt, drei Restwertangebote
Wirtschaftlichkeitsgebot: Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB muss der Geschädigte den wirtschaftlich vernünftigen Weg der Schadensbehebung wählen. Das gilt ausdrücklich auch für die Verwertung des Unfallfahrzeugs (Restwert). Der Bundesgerichtshof (BGH) betont, dass die Schadensersatzpflicht „von vornherein nur insoweit“ besteht, als sich die Verwertung im Rahmen wirtschaftlicher Vernunft hält. Zugleich erfolgt die Bewertung subjektbezogen: Es kommt auf Ihre Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten in Ihrer konkreten Lage an.
Allgemeiner regionaler Markt: Der Geschädigte leistet dem Wirtschaftlichkeitsgebot im Regelfall Genüge, wenn er sein Fahrzeug zu dem Preis veräußert, den ein von ihm beauftragter Sachverständiger als Restwert auf dem allgemeinen regionalen Markt ermittelt hat. Eigene Marktforschung überregional oder in Internet-Restwertbörsen schulden Sie grundsätzlich nicht.
Drei konkrete Angebote: Der Sachverständige hat als belastbare Schätzgrundlage regelmäßig drei Restwertangebote einzuholen und im Gutachten konkret zu benennen. Diese Dreizahl entspricht der Empfehlung des 40. Deutschen Verkehrsgerichtstages und ist vom BGH mehrfach bestätigt worden.
Diese drei Eckpfeiler sind in jüngster Zeit erneut vom BGH bekräftigt worden. In der Entscheidung vom 25.03.2025 (VI ZR 174/24) hebt der BGH hervor, dass die Restwertfrage Teil des Wirtschaftlichkeitsgebots ist und die individuelle Situation des Geschädigten zu berücksichtigen bleibt; zugleich genügt der Geschädigte regelmäßig, wenn er auf ein ordnungsgemäßes Gutachten mit konkreter regionaler Restwertermittlung baut.
Schnell handeln – aber richtig: Warum Tempo bei der Veräußerung hilft
Je schneller nach Gutachtenerstellung veräußert wird, desto eher vermeiden Sie Streitpunkte wie Standkosten, Verzögerungen und sich ändernde Marktpreise. Die Rechtsprechung stellt klar, dass Sie grundsätzlich nicht warten müssen, bis die gegnerische Versicherung „vielleicht“ ein höheres Restwertangebot übersendet. Solange ein korrektes, regionales Dreierangebot im Gutachten vorliegt, sind Sie berechtigt, sofort zum gutachterlich ermittelten (höchsten) Restwert zu verkaufen.
Der BGH hat wiederholt betont, dass der Geschädigte nicht verpflichtet ist, den Versicherer vorab um Stellungnahme zu bitten oder überregional/internetbasiert „bessere“ Angebote abzuwarten; die Abwicklung in eigener Regie ist gesetzlich gewollt. Dies wurde u. a. in den Entscheidungen VI ZR 358/18 (2019) und VI ZR 211/22 (2024) betont.
Ein praktisches Gegenbeispiel, wann ausnahmsweise ein Zuwarten geboten sein kann, ist selten – und dann nur, wenn die Versicherung vor dem Verkauf ein konkretes, zumutbares, verbindliches und oft sogar mit kostenloser Abholung verbundenes Höchstangebot vorlegt. Liegt ein solches annahmefähiges, höheres Angebot rechtzeitig vor, kann regelmäßig die Pflicht bestehen, es aus Schadensminderungsgründen zu berücksichtigen. Fehlt es daran, dürfen Sie verkaufen.
Der „Dreiklang“ im Gutachten: Drei regionale Restwertangebote – höchstes Angebot wählen
Warum drei? Die Dreizahl verhindert Zufallsergebnisse („Ausreißer“) und bildet den regionalen Markt zuverlässig ab. Deshalb verlangt der BGH, dass der Sachverständige regelmäßig drei konkrete regionale Angebote einholt und die Anbieter nennt.
Regionalität: Angebote müssen dem für Sie ohne weiteres zugänglichen regionalen Markt entstammen; internetbasierte Spezialbörsen sind regelmäßig kein Muss. Treffen die drei Angebote diese regionalen Anforderungen, genügt es, den höchsten dieser drei Werte als Restwert zugrunde zu legen.
Schriftliche Dokumentation: Halten Sie Angebot, Annahme und Kaufvertrag schriftlich fest (Kaufvertrag mit Datum, Anbieter, Betrag, etwaiger Abholungszusagen). Diese Dokumentation sichert den Nachweis der ordnungsgemäßen, wirtschaftlich vernünftigen Verwertung.
Auch Obergerichte folgen diesem Dreiklang: So hat das OLG Hamm bestätigt, dass der Geschädigte dem Wirtschaftlichkeitspostulat genügt, wenn er eines der drei im Gutachten genannten Restwertangebote – und zwar das höchste – realisiert. Maßgeblich ist der regionale Markt; auf internetbasierte Spezialbörsen kann der Geschädigte regelmäßig nicht verwiesen werden.
Abschleppunternehmen einbinden: Transportkosten vermeiden, Abwicklung erleichtern
Ist Ihr Fahrzeug abgeschleppt worden, lohnt stets die Nachfrage beim Abschleppunternehmen, ob ein Ankauf zum höchsten regionalen Restwert möglich ist. Das ist oft pragmatisch: Es erspart weitergehende Transport- und Standkosten, die sonst die Regulierung belasten können, und beschleunigt die Abwicklung vor Ort. Zudem enthalten manche Restwertangebote – auch aus der Versicherersphäre – ausdrücklich die Zusage einer kostenfreien Abholung; das zeigt, wie bedeutsam Logistik- und Transportkosten in der Restwertpraxis sind. Prüfen Sie daher stets, ob das Abschleppunternehmen die Abholung/Übernahme vor Ort mit abdeckt.
Wichtig: Bleiben Sie beim regionalen Markt. Wenn das Abschleppunternehmen als regionaler Anbieter auftritt und ein in das Dreier-Set passendes, verbindliches Höchstangebot stellt, kann der Verkauf dorthin besonders wirtschaftlich und komfortabel sein. Das beschleunigt die Auszahlung, vermeidet Doppel- oder Weitertransportkosten und hält Sie zugleich auf der sicheren Seite der Rechtsprechung.
Schriftlich verkaufen – warum die Form wichtig ist
Der Verkauf sollte stets schriftlich erfolgen: Es belegt Preis, Datum, Käuferdaten, Abholungsmodalitäten und ggf. die Anrechnung des Restwerts. Diese Klarheit hilft bei der anschließenden Regulierung, insbesondere wenn die Versicherung Fragen zur Höhe des Restwerts stellt oder behauptet, es habe ein höheres (später vorgelegtes) Angebot gegeben. Auch bei einem späteren Streit über den Zugang von Versichererangeboten zeigt eine lückenlose Dokumentation, dass Sie zügig und wirtschaftlich gehandelt haben.
Was gilt, wenn die Versicherung ein höheres Angebot schickt?
Vor dem Verkauf: Erhalten Sie vor der Veräußerung ein konkretes, zumutbares, verbindliches Höchstangebot (typischerweise mit kostenfreier Abholung, klarer Preisangabe und Ansprechpartner), kann ausnahmsweise eine Pflicht bestehen, dieses Angebot anzunehmen (Schadensminderungspflicht). Fehlt es an Verbindlichkeit, Zumutbarkeit oder rechtzeitiger Übermittlung, dürfen Sie zum höchsten regionalen Dreierangebot verkaufen.
Nach dem Verkauf: Haben Sie bereits veräußert, ist der erzielte Restwert maßgeblich. Ein nachträglich übersandtes „höheres“ Angebot bleibt regelmäßig unbeachtlich. Das Risiko, dass nach der Veräußerung andere (später) mehr geboten hätten, trägt grundsätzlich nicht der Geschädigte.
Nur regional und konkret zählt: Mehrfach hat die Rechtsprechung Internet-Höchstgebote verworfen, wenn sie nicht dem regionalen Markt entsprachen. Der BGH verlangt, dass die Restwertermittlung regional erfolgt und der Geschädigte nicht auf einen Sondermarkt im Internet verwiesen wird – es sei denn, besondere Konstellationen (z. B. professionelle Marktteilnehmer) rechtfertigen ausnahmsweise mehr.
Sonderfälle: Leasing, Sicherungsübereignung, gewerbliche Marktkenntnis
Die Rechtsprechung bleibt subjektbezogen: In besonderen Konstellationen – z. B. bei Leasinggeberinnen, Autohaus-Geschädigten oder Sicherungsnehmerinnen (Banken) – können strengere Anforderungen an die Restwertrecherche gelten, insbesondere wenn diese Akteure typischerweise über erweiterte Marktkenntnisse verfügen und ihnen die Nutzung überregionaler oder internetbasierter Restwertbörsen zumutbar ist. In der aktuellen BGH-Entscheidung vom 25.03.2025 (VI ZR 174/24) hat der Senat betont, dass bei gewerblich mit dem Automarkt vertrauten Eigentümern (hier: Sicherungsnehmerin/Bank) die Messlatte höher liegen kann; fehlt dem Geschädigten (Kläger) hierzu Vortrag, kann der Versicherer mit einem höheren (internetbasierten) Angebot durchdringen. Ergebnis dort: Anrechnung eines höheren, internetbasierten Restwerts. Für private Geschädigte ohne besondere Marktkenntnis gilt diese Verschärfung regelmäßig nicht.
Gleichzeitig hat der BGH (zuletzt am 02.07.2024 – VI ZR 211/22 – und am 25.06.2019 – VI ZR 358/18) den Grundsatz bestätigt: Der private Geschädigte darf grundsätzlich auf die korrekt ermittelte regionale Dreier-Restwertbasis vertrauen, ohne überregional zu recherchieren oder die Versicherung abzuwarten. Das Risiko einer „besseren“ internetbasierten Verwertung trägt dann nicht er.
Aktuelle Rechtsprechung im Überblick – was Sie wissen sollten
BGH, Urteil vom 25.03.2025 – VI ZR 174/24: Wirtschaftlichkeitsgebot gilt auch für den Restwert; subjektbezogene Betrachtung bleibt maßgeblich. Private Geschädigte genügen dem Gebot regelmäßig durch Verkauf zum im Gutachten regional und konkret ermittelten Restwert (drei Angebote). In Konstellationen mit gewerblich versierten Eigentümern (z. B. Sicherungsnehmerin/Bank) kann ein höheres, internetbasiertes Angebot maßgeblich sein, wenn die strengeren Maßstäbe greifen und der Kläger hierzu nicht hinreichend vorträgt.
BGH, st. Rspr. – u. a. 02.07.2024 – VI ZR 211/22; 25.06.2019 – VI ZR 358/18; 27.09.2016 – VI ZR 673/15; 13.10.2009 – VI ZR 318/08: Der Geschädigte genügt regelmäßig, wenn er auf ein korrektes Gutachten mit drei regionalen Angeboten baut; keine Pflicht zur Internetrecherche oder zum Abwarten eines etwaigen Versichererangebots vor Veräußerung. .
OLG Hamm, Urteil vom 26.04.2023 – 11 U 66/22: Realisiert der Geschädigte das höchste der drei im Gutachten ermittelten regionalen Angebote, genügt er dem Wirtschaftlichkeitsgebot; ein später vorgelegtes überregionales Angebot ist unbeachtlich, wenn es weder regional noch rechtzeitig ist.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.03.2018 – 1 U 55/17: Internetbasierte Einzelgebote ersetzen nicht die Ermittlung des regionalen Marktes anhand von mindestens drei Angeboten; Ausreißer sind abzufangen.
Praxishinweise aus der Rechtsprechung: Der Geschädigte darf sogleich zum gutachterlich ermittelten Restwert verkaufen; bloße Ankündigungen der Versicherung, „bald“ ein höheres Angebot zu schicken, genügen nicht. Entscheidend sind konkrete, rechtzeitig übermittelte, annahmefähige Angebote; ansonsten bleibt der Weg frei für die sofortige Veräußerung zum höchsten regionalen Dreierangebot.
Praxisleitfaden: So gehen Sie Schritt für Schritt vor
Sofort Sachverständigen beauftragen
Ziel: Feststellung Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert.
Achten Sie darauf, dass der Gutachter drei regionale Restwertangebote einholt, die Anbieter konkret benennt (mit Kontaktdaten) und die Regionalität nachvollziehbar ist. Nur so können Sie rechtssicher verkaufen.
Höchstes der drei regionalen Restwertangebote zugrunde legen
Sobald das Gutachten vorliegt, dürfen Sie den Verkauf zu diesem Höchstrestwert realisieren. Das genügt dem Wirtschaftlichkeitsgebot, wenn das Gutachten die korrekte Wertermittlung erkennen lässt.
Schriftlich verkaufen
Halten Sie Kaufpreis, Datum, Käufer, Abholmodalität, Fahrzeugdaten und ggf. Zusagen (kostenlose Abholung) schriftlich fest. Diese Dokumentation erleichtert die Regulierung und wehrt spätere Einwände ab.
Abschleppunternehmen ansprechen
Wenn das Fahrzeug bereits dort steht: Fragen Sie nach einem Ankauf zum höchsten regionalen Restwert. Häufig sind Logistik/Abholung schon organisiert; manche Angebote enthalten sogar eine kostenlose Abholung – das kann teure Weitertransporte vermeiden und die Abwicklung beschleunigen.
Versicherung informieren – aber nicht ausbremsen lassen
Sie sind nicht verpflichtet, vor Verkauf auf (mögliche) Versichererangebote zu warten. Kommt vor Veräußerung ein konkretes, verbindliches, zumutbares Höchstangebot, prüfen Sie es ernsthaft – sonst dürfen Sie zum höchsten regionalen Dreierangebot verkaufen.
Belege sammeln
Gutachten, drei Angebote, Kaufvertrag, Abholbestätigung, Zahlungsnachweis, Abschlepp-/Standkosten: Lückenlose Unterlagen beugen Streit vor und stützen Ihre Position.
Typische Einwände der Versicherung – und wie die Rechtsprechung darauf reagiert
„Sie hätten auf unser besseres Angebot warten müssen.“
Antwort: Ohne konkretes, verbindliches, rechtzeitig übermitteltes Angebot trifft Sie grundsätzlich keine Wartepflicht; Sie dürfen sofort zum höchsten regionalen Restwert veräußern. Bloße Ankündigungen („wir prüfen“, „bald Angebot“) genügen nicht.„Der regionale Markt ist zu klein – Internetbörsen bringen mehr.“
Antwort: Der BGH verlangt grundsätzlich den regionalen Markt. Auf überregionale oder internetbasierte Sondermärkte müssen private Geschädigte ohne besondere Marktkenntnis nicht ausweichen. Anders nur in Sonderkonstellationen (Leasinggeber, Autohaus, Bank als Sicherungsnehmerin) mit spezifischer Marktnähe.„Das Gutachten nennt keine drei regionalen Angebote/ist unklar.“
Antwort: Ein ordnungsgemäßes Gutachten muss drei regionale Angebote konkret benennen. Fehlt das, kann das Vertrauen eingeschränkt sein; hier empfiehlt sich die Nachbesserung durch den Sachverständigen. Liegen die drei Angebote vor und sind regional, genügt der Verkauf zum höchsten Angebot.„Unser Angebot war höher und enthielt kostenlose Abholung – das hätten Sie annehmen müssen.“
Antwort: Nur wenn dieses Angebot rechtzeitig vor dem Verkauf und für Sie zumutbar sowie verbindlich war, kann eine Annahmepflicht bestehen. Andernfalls bleibt Ihr Verkauf zum höchsten regionalen Dreierangebot rechtmäßig. Beachten Sie: Die kostenlose Abholung zeigt, dass Logistik eine entscheidende Rolle spielt – sie kann die Zumutbarkeit erhöhen.
Häufige Fehler – und wie Sie sie vermeiden
Zu wenig oder falsche Angebote: Achten Sie darauf, dass der Gutachter drei regionale, konkrete Angebote dokumentiert. Fehlen Regionalität oder Konkretisierung, leidet die Beweiskraft – und die Versicherung hat Angriffsfläche. .
Warten auf „Ankündigungen“: Verzögern Sie nicht unnötig. Ohne rechtzeitig übermittelte, konkrete Angebote der Gegenseite dürfen Sie umgehend verkaufen.
Unklare Verkaufsdokumentation: Der Verkauf muss schriftlich belegt werden (Kaufvertrag/Ankaufsschein mit Datum, Preis, Daten). Das vermeidet spätere Beweisnöte.
Teure Folgekosten: Prüfen Sie mit dem Abschleppunternehmen die Möglichkeit der Übernahme/Ankaufs vor Ort zum höchsten regionalen Restwert, um Weitertransporte und Standkosten zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob das Angebot eine kostenlose Abholung enthält.
Kurz-Fallstudien aus jüngerer Rechtsprechung
OLG Hamm 2023 (11 U 66/22): Geschädigter realisiert das höchste von drei regionalen Restwertangeboten; kein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot, selbst wenn die Versicherung später ein überregionales, höheres Angebot benennt, das weder regional noch rechtzeitig war. Ergebnis: Anspruch zugesprochen.
OLG Düsseldorf 2018 (1 U 55/17): Vier Internetgebote ersetzen nicht den regionalen Markt; drei regionale Angebote sind erforderlich, um Ausreißer zu vermeiden. Ergebnis: Der Geschädigte durfte sich am regionalen Dreier-Set orientieren.
BGH 2025 (VI ZR 174/24): Bei einer Sicherungsnehmerin/Bank als (Mit-)Berechtigte stellte der BGH auf strengere Maßstäbe ab; mangels Darlegung des Klägers zur subjektbezogenen Betrachtung setzte sich ein höheres internetbasiertes Angebot durch. Merksatz: Private dürfen regional bleiben; professionelle Marktakteure müssen ggf. mehr.
FAQ: Ihre wichtigsten Fragen zur Restwertveräußerung nach Totalschaden
Muss ich vor dem Verkauf auf ein Angebot der Versicherung warten?
Nein – sofern Ihr Gutachten eine korrekte Restwertermittlung auf regionaler Dreierbasis enthält. Nur ein rechtzeitig übermitteltes, verbindliches und zumutbares Höchstangebot kann ausnahmsweise vorgehen.Darf ich das Fahrzeug an das Abschleppunternehmen verkaufen?
Ja, wenn das Abschleppunternehmen ein in das regionale Dreier-Set passendes, verbindliches (idealerweise höchstes) Angebot stellt. Das ist regelmäßig sinnvoll, da Logistik und Abholung oft bereits organisiert sind; manche Angebote beinhalten kostenlose Abholung.Was passiert, wenn die Versicherung später ein höheres Internetangebot präsentiert?
Ist der Verkauf bereits erfolgt, bleibt Ihr erzielter (korrekt ermittelter) Restwert maßgeblich. Nur vor dem Verkauf rechtzeitig vorgelegte, zumutbare Angebote sind relevant.Was, wenn mein Gutachten keine drei regionalen Angebote enthält?
Bitten Sie den Sachverständigen um Ergänzung/Nachbesserung. Der BGH fordert regelmäßig drei regionale Angebote; das sichert Ihre Position erheblich.Muss ich überregional oder im Internet nach höheren Angeboten suchen?
Regelmäßig nein – für private Geschädigte genügt der regionale Markt. Sonderfälle (z. B. Leasinggeber, Autohaus, Bank als Sicherungsnehmerin) können strengere Anforderungen begründen.
Checkliste für die Mandantschaft
Auftrag an Sachverständigen mit klarer Vorgabe: drei regionale Restwertangebote, Anbieter benennen, Höchstwert dokumentieren.
Verkauf zum höchsten der drei regionalen Angebote. Zügig.
Schriftlicher Kaufvertrag mit Datum, Preis, Käufer, Abholmodalitäten.
Abschleppunternehmen ansprechen: Ankauf/Übernahme vor Ort zum Höchstrestwert? Kostenlose Abholung? So lassen sich Transport- und Standkosten vermeiden.
Versicherer informieren – aber nicht blockieren lassen: Nur konkrete, verbindliche, zumutbare und rechtzeitig übermittelte Angebote sind zu beachten.
Lückenlos dokumentieren: Gutachten, Angebote, Kaufvertrag, Zahlungsbeleg, ggf. Logistik-/Abholzusagen.
Fazit

Aus der Praxis.
Aktuell informiert.
Mietrecht
2026
Einstweiliger Rechtsschutz zeigt Wirkung – Vermieterin entfernt eigenmächtig angebrachte Schlösser
Mietrecht
2026
Wenn Nachbarn zu weit gehen
Verkehrsrecht
2025